Rückschau | Online-Seminar: Mehr Perspektiven, mehr Kompetenz: Erfolgreiche Rekrutierung von weiblichen Beschäftigten



Der Fachkräftemangel ist bereits heute für viele Unternehmen spürbar und wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Umso wichtiger ist es, das Potenzial weiblicher Fachkräfte gezielt in den Blick zu nehmen. Im Seminar „Mehr Perspektiven, mehr Kompetenz – Erfolgreiche Rekrutierung weiblicher Beschäftigte“ am 27.01.206 gab Verena Arps-Roelle rund 40 Personalverantwortlichen und Führungskräften wertvolle Einblicke in die Umsetzung von gendersensiblem Recruiting und zeigte, wie Unternehmen dadurch ihre Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern können.
Zu Beginn machte sie deutlich, dass viele Unternehmen das Thema umtreibt – oft begleitet von Unsicherheiten. Gendersensibles Recruiting sei dabei kein „Extra“, sondern die konsequente Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Authentizität spiele eine zentrale Rolle: Nur wer glaubwürdig kommuniziert und handelt, ziehe passende Bewerbende an und binde sie langfristig. Studien und Praxisbeispiele zeigen: Gendersensibles Recruiting führt zu mehr Bewerbungen, mehr Innovation und mehr Erfolg, wird bislang jedoch noch zu selten umgesetzt.
Anhand konkreter Beispiele analysierte die Referentin Bildsprache, Sprache und Prozesse im Recruiting. Bilder und Texte senden klare Signale darüber, wer willkommen ist und wer nicht. Frauen benötigen dabei keine Sonderrolle, sondern möchten ernst genommen, gesehen und in ihren Bedürfnissen anerkannt werden. Auch unbewusste Denkmuster („Unconscious Bias“) in Anzeigen, Auswahlverfahren und Abläufen gilt es zu reflektieren.
Im Fokus standen zudem konkrete Handlungsansätze für kleine und mittlere Unternehmen: transparente Angaben zu Gehalt, Arbeitszeitmodellen und Homeoffice, inklusive Bild- und Sprachgestaltung, eine positive Onboarding-Erfahrung sowie faire und strukturierte Auswahlprozesse. Besonders betont wurde, dass Authentizität ein echter Wettbewerbsvorteil ist und dass es nicht um Perfektion, sondern um das bewusste „Sich-auf-den-Weg-Machen“ geht.
Zum Abschluss stellte Verena Arps-Roelle praxisnahe Quick-Wins vor, mit denen Unternehmen direkt starten können: Von der Überarbeitung bestehender Stellenanzeigen über standardisierte Interviews bis hin zu verbindlichen, wertschätzenden Zu- und Absagen. Unterstützt wurden die Teilnehmenden durch Checklisten und Handouts, die zur Reflexion des eigenen Recruitings einladen und den Transfer in die Praxis erleichtern.
Es folgte eine Diskussionsrunde, in welcher Teilnehmende Fragen stellen und von eigenen Erfahrungen berichten konnten.
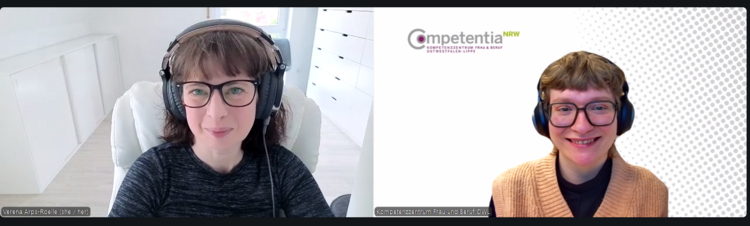
Referentin: (links) Verena Arps-Roelle, Aktivistin gegen sexualisierte Gewalt und Workshopmoderatorin der act & protect® Academy
Kim Lasche, Projektmanagerin Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Wie Gründerinnen ihr Selbstbewusstsein stärken und den eigenen Wert souverän in Verhandlungen vertreten können, stand im Mittelpunkt des zweistündigen Online-Seminars „Stärkung des Unternehmerinnen-Ichs: vom Selbstwert zum Marktwert – Verhandlungstango“. Rund 30 Gründerinnen und Jungunternehmerinnen nahmen an der Veranstaltung teil und setzten sich intensiv mit ihrer inneren Haltung, ihrem Preis und ihrer Rolle als Unternehmerin auseinander.
Zum Auftakt führte Referentin Imke Leith in das Bild des „Verhandlungstangos“ ein: Verhandeln ist kein Duell, sondern ein Zusammenspiel. Entscheidend sei dabei vor allem die innere Haltung – Selbstbewusstsein ist das A und O. Mit einer klaren Einstiegsformel ermutigte sie die Teilnehmerinnen, direkt Position zu beziehen: „Ich bin …“, „Ich möchte X verdienen“, „damit ich …“. Wer den eigenen Wert kennt, müsse ihn nicht rechtfertigen, sondern dürfe den Preis nennen – und anschließend bewusst schweigen.
Dass Selbstständigkeit immer auch Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, wurde im weiteren Verlauf deutlich. In Breakout-Sessions übten die Teilnehmerinnen in kleinen Gruppen, ihren Preis klar und selbstsicher auszusprechen. Die geschützten Übungsräume boten Gelegenheit, Hemmungen abzubauen und neue Sicherheit zu gewinnen.
Anschließend ging Imke Leith auf zentrale Verhandlungsgrundlagen ein und nutzte dafür das Eisbergmodell: Während Zahlen, Daten und Fakten sichtbar an der Oberfläche liegen, werden rund 95 Prozent aller Entscheidungen unbewusst getroffen. Gerade im Verkauf spiele daher die emotionale Ebene eine entscheidende Rolle. Gründerinnen seien gut beraten, nicht nur ihre Leistungen zu erklären, sondern die Bedürfnisse hinter den Problemen ihrer Kundinnen und Kunden zu erkennen. Jedes Angebot adressiert einen „Pain“ und schafft einen „Gain“ – und genau hier liegt der Mehrwert unternehmerischen Handelns.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Frage: Was verkaufen wir eigentlich? Neben Fach- und Methodenkompetenz sind es auch Sozialkompetenz und Zeit, die den Kern des Deals ausmachen – und an denen sich der Preis orientieren sollte. In einer weiteren Übungsphase reflektierten die Teilnehmerinnen ihr persönliches Alleinstellungsmerkmal und schärften ihr Profil.
Nach der Pause widmete sich die Referentin der Psychologie der Zahlen: Welche Preisuntergrenze ist realistisch? Wo liegt das Maximum? Ergänzt wurde dieser Teil durch Einblicke in Preisstrategien sowie die Marketingformel „know, like, trust“ – denn Vertrauen ist eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Verhandlungen.
Zwischendurch nahm sich Imke Leith immer wieder Zeit für Fragen und individuelle Anliegen, was den hohen Praxisbezug der Veranstaltung unterstrich.
Fazit: Wer den eigenen Wert kennt, kann ihn auch selbstbewusst vertreten. Verhandeln ist ein Lernprozess – und mit der richtigen Haltung, Klarheit und Übung wird aus Unsicherheit ein souveräner Tanz auf Augenhöhe.

Referentin: (links) Imke Leith, KELE-Coaching, stärkenorientierte Komfortzonendehnerin & Starkmacherin
Kim Lasche, Projektmanagerin Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Wie Unternehmen ihre Arbeitsumgebungen so gestalten können, dass sie in Zeiten von Digitalisierung, KI und hybrider Zusammenarbeit attraktiv und zukunftsfähig bleiben, erläuterte die Referentin, Zuzana Blazek am 04.12.2025 in der Online-Veranstaltung „Das Büro der Zukunft – in Zeiten von KI und Digitalisierung“. Die selbständige Unternehmensberaterin gab rund 80 Personalverantwortlichen und Führungskräften aus kleinen und mittleren Unternehmen zahlreiche praktische Tipps, wie das Büro der Zukunft gestaltet werden könnte.
Zu Beginn nahm sie die Teilnehmenden mit auf eine „Zeitreise“ und ging auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen ein – von Boomer bis Gen Z – und deren Einfluss auf Erwartungen an Arbeitsplätze. Besonders die jüngste Generation sei stark von Krisen geprägt und suche im Job Sinn, Stabilität, Gesundheit und Zugehörigkeit. Sie zeigte auf, dass das Büro heute weit mehr ist als nur Arbeitsplatz: Es dient der Bindung, schafft Gemeinschaft und macht Unternehmenskultur sichtbar. Um der Vielfalt der Generationen in den Unternehmen gerecht zu werden, sei es unerlässlich, die Arbeitsplatzgestaltung strategisch zu planen und an seine Mitarbeitenden individuell anzupassen.
Blasek betonte außerdem die Bedeutung von Resilienz im Team und stellte heraus, dass Bindung einer der wichtigsten Schutzfaktoren für psychisches Wohlbefinden sei. Das Büro könne hierzu wesentlich beitragen, indem es Räume für Begegnung, Fokus, Regeneration und Lernen bietet.
Praktische Empfehlungen umfassten u. a. gute Akustik, durchdachte Zonen für verschiedene Arbeitsmodi, gesundheitsfördernde Elemente, Services zur Entlastung sowie ein warmes, einladendes Design. Besonders für Frauen sei eine gelungene Bürogestaltung wichtig, da sie im Homeoffice stärker an Sichtbarkeit und Vernetzung verlieren.
Ihr Fazit: Ein psychologisch intelligentes Büro stärkt Resilienz, unterstützt Gesundheit und macht Unternehmen für qualifizierte Mitarbeitende attraktiv.


Oben: Referentin - Zuzana Blazek, Expertin für Employer Branding, Unternehmensberaterin und Speakerin mit eigener psychotherapeutischer Praxis in Köln | Petra Mattes - Projektmanagerin, Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL

Gesunde Führung beginnt bei mir selbst
Mit einem praxisnahen und inspirierenden Vortrag zum Thema „Führung mit Weitblick – Gesundheit als Führungsaufgabe“ zeigte Referentin Nina Kache am 07. Oktober 2025 rund 100 Führungskräften und Personalverantwortlichen, wie eng Wohlbefinden, Kommunikation und Führungskultur miteinander verbunden sind. Als Unternehmerin, Gründerin und Mutter von Zwillingen brachte sie eine doppelte Perspektive aus Theorie und Praxis mit – und machte deutlich, dass gesunde Führung immer bei einem selbst beginnt.
Zum Einstieg lud sie die Teilnehmenden zu einer kurzen Entspannungsübung ein. Schon wenige bewusste Atemzüge können helfen, innezuhalten – ganz ohne Yogamatte.
Anschließend zeigte die Referentin den starken Anstieg der durch psychische Erkrankungen verursachten Fehltage auf. Keine andere Erkrankungsgruppe hat in den letzten 20 Jahren so stark zugenommen. Hinzu kommt, dass Beschäftigte, die mental erkrankt sind, wesentlich länger ausfallen als bei einem Infekt.
Anschließend betonte Nina Kache, dass Anwesenheit nicht automatisch mit Produktivität gleichzusetzen ist. Studien zeigen, dass das Wohlbefinden entscheidend für Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist. Um das ungenutzte Potenzial zu nutzen, ist kein großes betriebliches Gesundheitsmanagement nötig, vielmehr sollte mit einer achtsamen Gestaltung des Arbeitsalltags begonnen werden.
Ihre Aussage war besonders eindrücklich: „Gesunde Führung beginnt bei mir selbst.” Wie im Flugzeug gilt: Zuerst muss ich mir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, um dann anderen helfen zu können. Nur wer sich selbst gut pflegt, kann auch seinen Mitarbeitenden achtsam und unterstützend begegnen. Außerdem sind Führungskräfte Vorbilder und sollten mit gutem Beispiel vorangehen.
Anschließend sprach sie über den Gender Care Gap und erinnerte daran, dass Frauen nach wie vor den Großteil der Carearbeit leisten. Familienfreundlichkeit müsse daher Teil der Unternehmenskultur sein. Gute Führung bedeute, Kulturgestalterin zu sein – mit Empathie, klaren Grenzen und einer wertschätzenden Haltung. Wenn das Kind eines Mitarbeitenden krank ist, sollte man besser fragen: „Was brauchst du?“, statt noch mehr Stress auszulösen.
Anhand eines Baum-Modells veranschaulichte Kache die sechs Dimensionen gesunder Führung: Stressbewältigung, Betriebsklima, Transparenz, Kommunikation, Interesse und Anerkennung/Wertschätzung. Kleine Gesten, wie ein ehrlich gemeintes „Ich sehe, was Sie leisten“, könnten dabei eine große Wirkung entfalten.
In einer abschließenden Reflexionsrunde wurden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, ihr eigenes Führungsverhalten zu hinterfragen:
Wie gehe ich mit Vereinbarkeit um? Was lebe ich meinem Team in Sachen Selbstfürsorge vor? Und wie oft nehme ich mir wirklich Zeit, einfach nur zuzuhören?
Fazit: Gesunde Führung ist keine zusätzliche Maßnahme, sondern die Art und Weise, wie wir täglich miteinander arbeiten. Es sind die kleinen Schritte und die aufrichtige Wertschätzung, die den Unterschied machen.
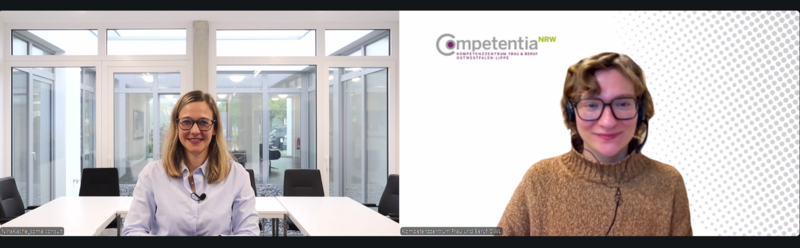
Referentin: (v.l.n.r.) Nina Kache, COO von soma consult, Diplom Sportwissenschaftlerin, Vorbildunternehmerin seit 2014, Vorstand der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V.
Kim Lasche, Projektmanagerin Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Minden-Lübbecke ausgezeichnet
69 Betriebe erhalten die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen 2025“
Familienfreundlichkeit ist im Kreis Minden-Lübbecke gelebte Realität – das zeigte die feierliche Verleihung der Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen 2025“. Im LWL-Preußenmuseum Minden wurden am 11. September insgesamt 69 Unternehmen für ihr besonderes Engagement bei der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf geehrt. Landrat Ali Dogan und Björn Böker, Geschäftsführer der OstWestfalenLippe GmbH, überreichten die Urkunden im festlichen Rahmen.
Seit 2015 wird die Auszeichnung an Unternehmen vergeben, die mit kreativen und passgenauen Maßnahmen ihre Mitarbeitenden unterstützen. Die Bandbreite reicht von Homeoffice- und Gleitzeitregelungen über Zuschüsse zur Kinderbetreuung oder Kinderferienhäuser, in denen Kinder die Ferien betreut verbringen können, bis hin zu Familiensommerfesten, Firmenfahrzeugen oder Lastenfahrrädern zur privaten Nutzung sowie Freikarten für Kultur- und Sportveranstaltungen.
Zunehmend rückt auch das Thema „Pflege“ in den Fokus: Viele Betriebe lassen Mitarbeitende zu Pflegeguides ausbilden, um Beschäftigte bei der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu unterstützen. Zudem setzen immer mehr Unternehmen auf Mitarbeiter-Apps, um ihre Angebote transparent und niedrigschwellig zugänglich zu machen.
Dass Familienfreundlichkeit längst kein „Nice-to-have“ mehr ist, betonte Landrat Ali Dogan: „Familienfreundlichkeit ist ein strategischer Faktor und entscheidender Wettbewerbsvorteil. Weniger Fehlzeiten und eine geringere Fluktuation zeigen klar, dass familienfreundliche Personalpolitik auch ökonomisch sinnvoll ist.“
Auch Björn Böker hob hervor: „Wer die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege ernst nimmt, gewinnt motivierte Mitarbeitende und stärkt zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit. Davon profitiert nicht nur jedes einzelne Unternehmen, sondern auch der gesamte Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe, der sich damit im Wettbewerb um Arbeitskräfte zukunftsfest aufstellt.“
Die wachsende Bedeutung zeigt sich auch in den Bewerbungen: Während sich 2015 noch 9 Unternehmen beteiligten, reichten 2025 bereits 70 Betriebe ihre Unterlagen ein – davon 53 zum wiederholten Mal. Die ausgezeichneten Unternehmen spiegeln die Vielfalt der regionalen Wirtschaft wider: von Kleinbetrieben mit 2 Mitarbeitenden bis hin zu Großunternehmen mit 20.000 Beschäftigten.
Im Anschluss an die Veranstaltung nutzen die Unternehmen die Möglichkeit zu Netzwerken.
Das dreistufige Auszeichnungsverfahren umfasst die Prüfung der Bewerbungsunterlagen, Online-Präsentationen sowie Unternehmensbesuche. Über die Vergabe entscheidet eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern von IHK, HWK, Agentur für Arbeit, Arbeitgeberverband Minden-Lübbecke e.V., DGB, Kreis Minden-Lübbecke und dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL.
Die Auszeichnung wird von der OstWestfalenLippe GmbH im Rahmen des Landesprogramms Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL in Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke, der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld sowie der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld vergeben.

Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Herford ausgezeichnet
48 Betriebe erhalten die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen 2025“
Familienfreundlichkeit ist im Kreis Herford gelebte Realität – das zeigte die feierliche Verleihung der Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen 2025“. Im Kreishaus Herford wurden am 8. September insgesamt 48 Unternehmen für ihr besonderes Engagement bei der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf geehrt. Landrat Jürgen Müller und Björn Böker, Geschäftsführer der OstWestfalenLippe GmbH, überreichten die Urkunden im festlichen Rahmen.
Seit 2015 wird die Auszeichnung an Unternehmen vergeben, die mit individuellen und kreativen Maßnahmen ihre Mitarbeitenden unterstützen. Die Bandbreite der Angebote ist groß: von Homeoffice- und Gleitzeitregelungen, über Zuschüsse zur Kinderbetreuung bis hin zu Familiensommerfesten, Firmenfahrzeugen oder Lastenfahrrädern zur privaten Nutzung sowie Freikarten für Kultur- und Sportveranstaltungen. In diesem Jahr überzeugten viele Betriebe zudem mit dem Einsatz von Pflegeguides, die Beschäftigte bei der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege unterstützen.
Dass das Thema an Bedeutung gewinnt, zeigt ein Blick auf die Entwicklung: Reichten im Jahr 2015 noch 9 Unternehmen eine Bewerbung ein, waren es 2025 bereits 51 Betriebe – davon 41 zum wiederholten Mal. Unter den Ausgezeichneten finden sich Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen – von kleinen Betrieben mit 10 Mitarbeitenden bis hin zu großen Arbeitgebern mit 2.800 Beschäftigten.
Landrat Jürgen Müller hat die Urkunden in diesem Jahr mit großer Freude überreicht: „Bei der ersten Auszeichnungsfeier vor einigen Jahren hatten wir neun Bewerbungen. In diesem Jahr gab es bereits über 50. Das zeigt mir: Familienfreundlichkeit wird bei uns im Kreis Herford gelebt. Und das ist auch gut so: Denn Familienfreundlichkeit ist kein „Nice-to-have“, sondern ein echter Standort- und Wettbewerbsvorteil – für Unternehmen, Beschäftigte und die Gesellschaft“.
„Wer die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege ernst nimmt, gewinnt motivierte Mitarbeitende und stärkt zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit. Davon profitiert nicht nur jedes einzelne Unternehmen, sondern auch der gesamte Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe“, betonte Björn Böker in seiner Ansprache.
Im Anschluss an die Veranstaltung nutzen die Unternehmen die Möglichkeit zu Netzwerken.
Das dreistufige Auszeichnungsverfahren umfasst die Prüfung der Bewerbungsunterlagen, Online-Präsentationen der erneut teilnehmenden Unternehmen sowie Unternehmensbesuche. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von IHK, HWK, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Kreis Herford, Arbeitgeberverband, Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V., DGB, Interkommunaler Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herford und dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL.
Die Auszeichnung wird von der OstWestfalenLippe GmbH im Rahmen des Landesprogramms Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL in Kooperation mit dem Kreis Herford, der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld sowie der Interkommunalen Wirtschaftsförderung im Kreis Herford vergeben.

Familienfreundlichkeit ist im Kreis Paderborn gelebte Realität – das zeigte die Verleihung der Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen 2025“. Insgesamt wurden 107 Unternehmen für ihr Engagement bei der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf geehrt. Landrat Christoph Rüther und Björn Böker, Geschäftsführer der OstWestfalenLippe GmbH, überreichten im Kongresshaus in Bad Lippspringe im feierlichen Rahmen die Urkunden.
„Der Kreis Paderborn hat eine starke Unternehmerschaft, die weiß, worauf es ankommt. Ich bin stolz darauf, dass sich so viele Unternehmen stetig weiterentwickeln. Die Familie ist ein hohes Gut - und deshalb lohnt sich das Engagement für das betriebliche Miteinander und den wirtschaftlichen Erfolg“, gratulierte Landrat Christoph Rüther.
Auch Björn Böker unterstrich, dass Familienfreundlichkeit ein zentraler Erfolgsfaktor ist. „Wer die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege ernst nimmt, gewinnt motivierte Mitarbeitende und stärkt zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit. Davon profitiert nicht nur jedes einzelne Unternehmen, sondern auch der gesamte Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe, der sich damit im Wettbewerb um Arbeitskräfte zukunftsfest aufstellt.“
Im Anschluss an die Urkundenübergabe nutzten die Unternehmen die Gelegenheit sich zu vernetzen und es entstand ein reger Austausch, aus dem die Teilnehmenden viele neue Impulse mitnehmen konnten.

Zwischen Vertrauen, Leistung und Selbstfürsorge
Am 14.08.2025 beleuchteten die Referentinnen Marie Homann und Katja Maas (Organisationsberatung Rheingans) das Thema „Führung im Spagat der Erwartungen“ für ca. 85 Personalverantwortliche und Führungskräfte.
Zum Auftakt stimmten sich die Teilnehmenden mit einer Mentimeter-Umfrage ein: „Was ist Dein größter Spagat in Deiner Führungsposition?“ Die Antworten reichten von Zeitmanagement und Veränderungsprozessen bis hin zu Motivation und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die Referentinnen führten anschließend in das Bild vom „Spagat“ ein – nicht als Entweder-oder, sondern als ständiges Austarieren zwischen verschiedenen Polen: Privat und Beruf, Mensch und Technik, Präsenz und Homeoffice, Tradition und Innovation, die eigenen Bedürfnisse und die des Teams. Diese Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig und werden zusätzlich von äußeren Rahmenbedingungen geprägt.
Ein Blick in die Vergangenheit verdeutlichte, wie sehr sich Führungsarbeit gewandelt hat: Früher standen Kontrolle und starre Strukturen im Vordergrund, heute zählen Vertrauen, Freiräume, agile Arbeitsweisen und Anpassungsbereitschaft. Homann beschrieb die verschiedenen Ebenen, auf denen Führung wirkt – „Ich mit Mir“, „Ich mit Anderen“ und „Ich als Teil der Organisation“. Dabei spiele auch die eigene Stressbewertung eine Rolle: Wer bewusst wahrnimmt, wie er Situationen einordnet, kann gezielter reagieren. Maas und Homann gaben praxisnahe Tipps wie aktives Zuhören, neutrale Formulierungen und kleine Tools zur Stärkung der Resilienz – etwa Mikropausen, Rituale und nicht zuletzt Humor.
Im Abschnitt „Ich mit Anderen“ ging es um Erwartungen an Führungskräfte, die in der zweiten Mentimeter abgefragt wurden. Maas stellte die Kernaufgaben von Führung vor und erläuterte das Konzept des „Servant Leader“: Menschen befähigen, Räume eröffnen, Hindernisse aus dem Weg räumen. Ergänzt wurde dies um konkrete Ansatzpunkte, die Zusammenarbeit flexibel, effizient und zukunftsfähig zu gestalten – von Fokuszeiten über digitale Tools bis hin zu psychologischer Sicherheit im Team.
Den Abschluss bildete die Ebene „Ich und die Organisation“. Hier stand die Unterscheidung zwischen direkter Führung im System und indirekter Führung am System im Mittelpunkt.
Zum Abschluss hatten die Teilnehmen die Möglichkeit Frage zu stellen. In der Diskussion ging es um den Spagat zwischen Tagesgeschäft und strategischer Ausrichtung sowie um den Umgang mit Generationenunterschieden beim Thema Resilienz und Gesundheitsbewusstsein. Ein Vorschlag aus der Runde: Mitarbeitende stärker in den Austausch bringen – denn nicht jede Nuance lässt sich allein von der Führungskraft erfassen.
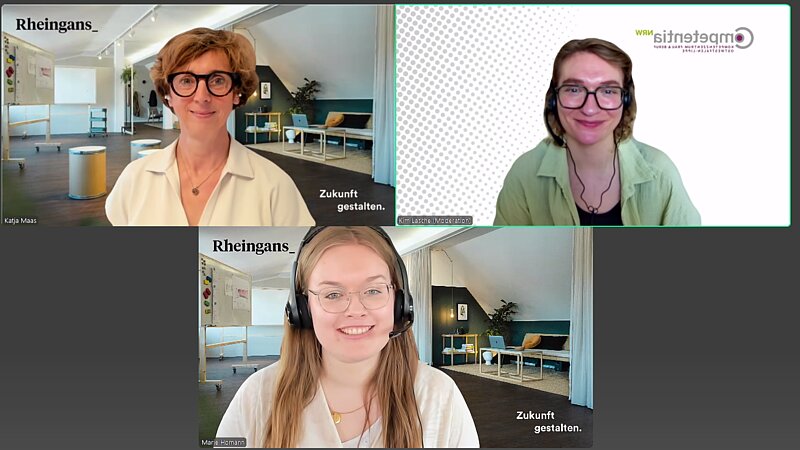
Referentinnen: (oben links) Katja Maas (Senior Beraterin bei Rheingans) ist gelernte Diplom-Ingenieurin und seit vielen Jahren als Beraterin und Trainerin in der Organisationsentwicklung mit dem Fokus Führung zu Hause. ( Bild unten ) Marie Homann ist Psychologin und arbeitet als Beraterin und Trainerin bei Rheingans.
Oben rechts: Kim Lasche - Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL

Zwei Perspektiven – eine Mission: Junge Menschen für Ausbildung begeistern
Am 03.06.2025 beleuchteten zwei Referent*innen das Thema „Ghosting vermeiden - wie Ansprache und Einbindung von Nachwuchskräften gelingt“ rund 85 Personalverantwortlichen und Führungskräften aus kleinen und mittleren Unternehmen in OWL.
Mit einem praxisnahen Impuls startete Joana Beste, Gründerin u.a. der digitalen Berufsorientierungsplattform knowlist, in die Veranstaltung. Als gelernte Fachinformatikerin kennt sie den männerdominierten IT-Bereich aus eigener Erfahrung – und bringt zugleich die Perspektive der Generation Z in die Diskussion um modernes Recruiting ein.
Anhand eines fiktiven, aber realitätsnahen Beispiels („Lena“, 16, Gesamtschülerin in OWL) machte sie deutlich, woran viele Personalverantwortliche im Kontakt zu Azubis auf Messen scheitern: „Das ist kein Desinteresse – das ist Überforderung.“ Junge Menschen fühlen sich oft unsicher im Erstkontakt. Ihre Empfehlung: Unternehmen sollten selbst aktiv werden, viele Fragen stellen, mit ihren Azubis arbeiten – und nach dem Erstkontakt unbedingt dranbleiben. Praktische Hinweise wie z.B. eine mobiloptimierte Karriereseite, gendersensible Sprache und transparente Infos zur Ausbildung rundeten ihren Beitrag ab. Der „Gamechanger Praktikum“ wurde besonders betont – als niedrigschwellige Möglichkeit, Vertrauen und Neugier zu wecken.
Im zweiten Teil stellte Laura Madroch, Teamleiterin Personalentwicklung bei KÖGEL Bau GmbH & Co. KG anschaulich das Best-Practice-Konzept ihres Unternehmens vor. Unter dem Motto „Wir begleiten den Weg – nicht nur den Einstieg“ schilderte sie, wie Kögel Bau Pre- und Onboarding gestaltet: vom Starterpaket nach Hause über die Einladung der Eltern zur Vertragsunterzeichnung bis hin zu gezielten Workshops für Azubis. Auch die Dokumentation der Einarbeitung, ein Ausbildungskompass und die Sensibilisierung der Ausbilder*innen für die Lebenswelt der jungen Generationen spielen dabei eine zentrale Rolle.
Beide Beiträge zeigten eindrucksvoll, wie zeitgemäßes Azubi-Recruiting und -Onboarding gelingen kann – mit Offenheit, Empathie und einem klaren Blick auf die Bedürfnisse junger Menschen.
Zum Abschluss hatten die Teilnehmenden noch die Möglichkeit Fragen zu stellen.


Oben: Kim Lasche - Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
Unten: Referentin (linkes Bild) Joana Beste Fachinformatikern, Gründerin Swipeflow und knowlist & Expertin für Ansprache und Einbindung von Gen Z, Referentin (rechtes Gild) Laura Madroch, Teamleitung Personalentwicklung und Ansprechpartnerin für Auszubildene bei KÖGEL Bau

Sichtbarkeit ist ein zentraler Faktor für den unternehmerischen Erfolg – besonders in der Anfangsphase einer Gründung. Wer sichtbar ist, erhält leichter Zugang zu Netzwerken, Unterstützung und anderen wertvollen Ressourcen. Wie man aus dem Schatten tritt und den Schritt in die Sichtbarkeit wagt, war Thema der Präsenzveranstaltung am 9. April 2025. In Kooperation mit der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld fand das Event in den Räumlichkeiten der Volksbank Ostwestfalen in Bielefeld statt.
Nach der Begrüßung durch Vertreterinnen der IHK, des Kompetenzzentrums Frau und Beruf sowie der Volksbank, richtete Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, persönliche Worte an die rund 100 anwesenden Gründerinnen. Als erste Frau in ihrer Position war es ihr ein besonderes Anliegen, den Teilnehmerinnen Mut zu machen. Noch immer gründen Frauen seltener – nicht aus Mangel an Ideen oder Kompetenzen, sondern weil sie häufig mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert sind: fehlende Unterstützungsstrukturen, mangelnde Vorbilder und eingeschränkte Sichtbarkeit. Umso wichtiger sei eine Veranstaltung wie diese, so Pigerl-Radtke.
Durch das Programm führte Nathalie Emas – ehemalige Absolventin unserer Gründerinnenakademie und Gründerin von Superheldinnen Coaching. Auch sie betonte die Bedeutung von Vorbildern: „You can’t be what you can’t see.“
Den inhaltlichen Auftakt gestaltete Janina Ostendorf, Gründerin von JULES, mit einer inspirierenden Keynote. Offen und authentisch teilte sie ihre persönliche Geschichte: Wie sie lernte, nicht darauf zu warten, „entdeckt“ zu werden, sondern selbst den Schritt in die Sichtbarkeit zu gehen. „Sichtbarkeit ist ein Gamechanger“, betonte sie. Viele denken dabei sofort an Branding und Online-Präsenz – doch Sichtbarkeit beginne im Alltag: „Immer, wenn du das Haus verlässt und mit Menschen in den Dialog trittst, wirst du sichtbar.“ Allein durch die Teilnahme an der Veranstaltung hätten die Gründerinnen diesen ersten Schritt bereits gemacht. Ihr abschließender Appell: „Wartet nicht auf den perfekten Moment – der kommt vielleicht nie. Fangt einfach an. Es könnte ja gut werden.“
Im anschließenden Panel teilten die Gründerinnen Mia Feldmann (Feldmann Nachhaltigkeitsberatung, Mirai Nachhaltigkeit), Minever Zevker (Miss Minevers) und Jessie Woelke (No Planet B) offen ihre Wege in die Sichtbarkeit. Unter der Moderation von Nathalie Emas wurden zentrale Fragen beleuchtet. Jessie Woelke berichtete, wie viel positive Energie es gebe, wenn man über die eigenen Herzensthemen spricht. Minever Zevker ergänzte, dass es ein „Next Level Selbstvertrauen“ brauche, wenn man beginnt, sich selbst sichtbar zu machen. Mia Feldmann bestätigte das – und alle drei waren sich einig: Sichtbarkeit stärkt das Selbstbewusstsein mit jeder neuen Erfahrung.
Auch das Thema Vereinbarkeit von Gründung und Care-Arbeit spielte eine wichtige Rolle. Alle drei Frauen kennen die Herausforderungen – und waren sich doch einig: Auch wenn es manchmal anstrengend sei, lohne sich der Weg. Die Stärke und Offenheit dieser beeindruckenden Gründerinnen wirkte inspirierend – und motivierte die Teilnehmerinnen, ihren eigenen Weg in die Sichtbarkeit weiterzugehen.
Anschließend vernetzten sich die Gründerinnen bei einem kleinen Imbiss.
Auf dem Foto zu sehen: v.l. Janina Ostendorf (JULES), Mineva Zevker (Miss Mineva´s), Mia Feldmann (Feldmann Nachhaltigkeitsberatung), Jessie Wölke (No Planet B), Kim Lasche (Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL), Nathalie Emas (Moderatorin), Kathrin Teschke (IHK Ostwestfalen), Petra Pigerl Radtke (Hauptgeschäftsführerin IHK Ostwestfalen), Sabrina Frederking (Volksbank in Ostwestfalen)