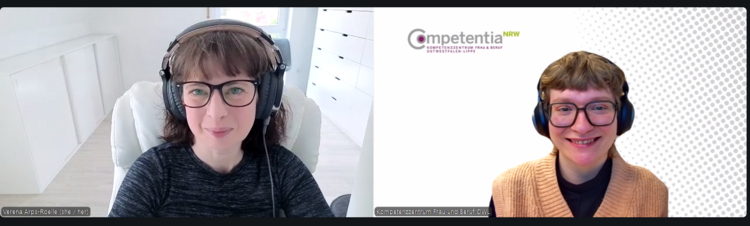OWL Kulturbüro
13.01.2026
Regionales Kultur Programm NRW (RKP): Zehn Projekte aus Ostwestfalen-Lippe erhalten Förderempfehlung für 2026
Link kopieren
Das Land Nordrhein-Westfalen hat auf Grundlage der Juryentscheidungen Ende 2025 zehn Projekte aus der Kulturregion Ostwestfalen-Lippe zur Förderung im Rahmen des Regionalen Kultur Programms NRW empfohlen.
Gemeinsam mit neun bereits bewilligten mehrjährigen Projekten fließen im Jahr 2026 somit erneut deutlich mehr als eine halbe Million Euro aus dem Landesförderprogramm in die Region. Das OWL Kulturbüro freut sich gemeinsam mit den Kulturschaffenden über diese starke Unterstützung.
Vielfältige Projekte stärken die Kulturregion OWL
Die Bandbreite der geförderten Vorhaben unterstreicht die künstlerische Vielfalt und Qualität in Ostwestfalen-Lippe: Von Theater und Tanz über kulturelle Bildung bis hin zu interdisziplinären Festival- und Netzwerkformaten ist ein breites Spektrum vertreten.
Björn Böker, Geschäftsführer der OWL GmbH, betont: „Kulturelle Vielfalt ist ein wesentlicher Standortfaktor für Ostwestfalen-Lippe. Die Landesförderung des Regionalen Kultur Programms trägt maßgeblich dazu bei, die künstlerische Qualität und die große Bandbreite an Projekten und Kooperationen in unserer stark vernetzten Kulturlandschaft sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln. Das Programm fördert insbesondere Kooperationsprojekte, die Kulturinstitutionen, freie Initiativen und kommunale Partner zusammenbringen und dadurch neue Impulse für die Region setzen. Mit der RKP-Förderung und der Arbeit des OWL Kulturbüros stärken wir nicht nur die Kultur – wir stärken die Zukunftsfähigkeit unserer gesamten Region.“
Beratung und Unterstützung durch das OWL Kulturbüro
Als eines von zehn regionalen Kulturbüros berät das OWL Kulturbüro Kulturschaffende in der Region bei der Entwicklung und Finanzierung ihrer Projekte. Darüber hinaus werden durch das Kulturbüro Fortbildungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsmaßnahmen umgesetzt, die die Kulturlandschaft nachhaltig stärken. Das Regionale Kultur Programm NRW ist ein Förderinstrument des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stärkung kultureller Vielfalt, Qualität und regionaler Zusammenarbeit.
Förderempfehlung 2026: Neu empfohlene Projekte im Rahmen des Regionalen Kultur Programms NRW
Für das Förderjahr 2026 wurden zehn Projekte aus Ostwestfalen-Lippe zur Förderung im Rahmen des Regionalen Kultur Programms NRW empfohlen. Dazu zählt zunächst die „19. OWL Kulturkonferenz“ des OWL Kulturbüros der OstWestfalenLippe GmbH, die als zentrales Netzwerkformat für Kulturschaffende in der Region weiterentwickelt wird.
Ebenfalls eine Förderempfehlung erhält das Projekt „BURGBEBEN STRNBRG“, das ein Netzwerk rund um die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bega organisiert. Das Subkultur-Festival für Jugendliche und junge Erwachsene rund um die historische Burganlage in Extertal setzt ein starkes kulturelles Zeichen im ländlichen Raum und erreicht Besuchende aus ganz Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus.
Mit Hilfe der RKP-Förderung möchte das Theaterlabor Bielefeld e. V. in Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen das Projekt „Kultur an lebendigen Orten“ realisieren. Durch künstlerische Aktionen und kulturelle Begegnungsformate im öffentlichen Raum schafft das Projekt neue Zugänge und ermöglicht kulturelle Teilhabe für unterschiedliche Zielgruppen.
Ein großes theaterpädagogisches Bündnis aus OWL erhält über den Antrag der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld eine Förderempfehlung für das „OWL-Theaterjugendclubtreffen“. Das Projekt stärkt den Austausch, die künstlerische Entwicklung und die Vernetzung junger Theatergruppen aus der gesamten Region.
Mit dem Projekt „Welt im Dorf – Dorf in der Welt“ lädt ein Netzwerk rund um den Heimat- und Verkehrsverein Schwalenberg e. V. fünf international tätige Jazzmusiker ein. Es entsteht ein Projekt, das lokal verankert ist, regional ausstrahlt und zugleich international sichtbar macht, wie engagierte Kulturarbeit im ländlichen Raum urbane Wirkung entfalten kann.
In Kooperation mit zahlreichen Partnern erhält die Theaterwerkstatt Bethel eine Förderempfehlung für das Projekt „Über_Leben – Ein regionales Volxkultur-Projekt in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen“. Das Vorhaben schafft kulturelle Teilhabe und reflektiert gesellschaftliche Entwicklungen durch künstlerische Zugänge und gemeinschaftliche Formate.
Eine Förderung ist zudem für die interdisziplinäre Theaterproduktion „Bandels Traum (fool on the hill)“ des Theaters Gütersloh vorgesehen, die gemeinsam mit jungen Kulturschaffenden entwickelt und zum 150. Todestag von Ernst von Bandel (1800–1876) uraufgeführt wird.
Mit „Tanz OWL“, getragen von Tanz OWL und vertreten durch das Kulturamt Bielefeld, erhält ein starkes Bündnis eine Förderempfehlung, das zeitgenössische Tanzformen in OWL nachhaltig verankern möchte. Im Mittelpunkt stehen der Zugang zu zeitgenössischem Tanz, künstlerische Vielfalt und umfassende kulturelle Teilhabe.
Ebenfalls empfohlen wurde die „Talentakademie OWL nextStage – Mentoring in Musik & Tanz“ der Musik- und Kunstschule Bielefeld, ein Programm zur professionellen Nachwuchsförderung in den Bereichen Musik und Tanz sowie erstmals auch in der Musikpädagogik.
Abgerundet wird die Liste durch das Hecken-Festival „Auf’s Land zum ersten Weißdorn“ des Europäischen Laboratoriums e. V., ein innovatives Festivalformat im ländlichen Raum, das Kunst, Naturerlebnis und gemeinschaftliche Aktivitäten auf neue Weise miteinander verbindet.
Weitere Informationen und zur RKP Förderung und der Arbeit des OWL Kulturbüros finden Sie finden Sie unter https://www.ostwestfalenlippe.de/owl-gmbh/owl-kulturbuero/