Deutscher Fahrradpreis für Radnetz OWL

1. Preis für das REGIONALE-Projekt Radnetz OWL: Paderborns Landrat Christoph Rüther (m.) nahm den ersten Preis stellvertretend in Köln von Laudatorin Christine Fuchs (l.) entgegen. REGIONALE-Leiterin Annette Nothnagel war digital zugeschaltet. Moderation Anna Planken (r.).
Das Infrastrukturkonzept Radnetz OWL wurde mit dem 22. Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet. Dies gab die Jury im Rahmen der feierlichen Preisverleihung beim AGFS-Kongress zum Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz heute bekannt. Beworben hatten sich 128 Projekte um die renommierte Auszeichnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Preisgeld von 5.000 € und eine Bronze-Fahrradtrophäe.
„Sie haben alle Kommunen an einen Tisch geholt und ein zukunftsfähiges Radnetz entwickelt. Dafür gab es viel Lob von der Jury. Die interkommunale Zusammenarbeit und Koordination für die Umsetzung eines alltagsfähigen Radnetz ist beispielhaft. Spätestens damit ist es vorbei, dass man sagt, auf dem Land kann man nicht Fahrrad fahren“, würdigte Laudatorin Christine Fuchs, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.
Das Radnetz OWL skizziert ein Wegenetz mit einer Länge von insgesamt ca. 2.000 Kilometern und nimmt schnelle und direkte Verbindungen der Kommunen untereinander in den Blick. Im Rahmen der REGIONALE 2022 haben sich die sechs Kreise Paderborn (federführend), Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und die Stadt Bielefeld auf den Weg gemacht, eine gemeinsame Radinfrastruktur mit abgestimmten Standards zu entwickeln. Dafür haben sich Fachleute der 70 Städte und Gemeinden der Region, der Bezirksregierung Detmold und von Straßen.NRW gemeinsam mit der Entwicklung der Verbindungsstrecken zwischen den Orten in OstWestfalenLippe und dem Anschluss zum ÖPNV beschäftigt.
PaderbornsLandrat Christoph Rüther nahm den ersten Preis stellvertretend in Köln entgegen: „Wir in OWL sind Deutscher Fahrradpreis 2022: Unsere gemeinsame Vision für zwei Millionen Menschen in sechs Kreisen und einer kreisfreien Stadt für einen gesunden und klimafreundlichen Alltag auf dem Rad ist mit dem ersten Preis in diesem bundesweiten Wettbewerb gewürdigt worden. Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung, die eindrucksvoll zeigt, was möglich ist, wenn eine Region zusammensteht, ihre Ressourcen bündelt und gemeinsam nach vorne schaut. Davon profitieren die Menschen, die sich auf sichere, direkte und komfortable Radwege, auf noch mehr Lebensqualität auf zwei Rädern freuen dürfen.“
„Das Radnetz OWL ist ein Leuchtturmprojekt und wegweisend für den Zusammenschluss einer fahrradfreundlichen Region wie unserer. Die bundesweite Auszeichnung verleiht dem Radverkehr in OWL zusätzlich Aufwind, treibt die praktische Umsetzung voran und wird damit zum echten Standortvorteil für die Region“, lobt Herbert Weber, Geschäftsführer der OWL GmbH.
Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fahrradpreis zeigt die Innovation, die hinter dem OWL-weiten Verbund zum Radnetz steckt. Landrat Dr. Axel Lehmann, Kreis Lippe: „Wollen wir eine langfristige Verkehrswende erreichen, brauchen wir Projekte, die nicht an Kreisgrenzen enden, und den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität attraktiver machen. Deshalb stellen wir die Bedürfnisse der Radfahrerinnen und Radfahrer in den Mittelpunkt und richten die Infrastruktur danach aus.“
Landrätin Anna Katharina Bölling, Kreis Minden-Lübbecke, unterstreicht: „Wir denken neu, wir denken um, und wir denken gemeinsam über Kreis- und Stadtgrenzen hinaus mit dem Radnetz OWL. So entstehen neue Wege nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass der Deutsche Fahrradpreis 2022 unser Projekt würdigt und damit auch über die Region hinaus bekannter macht – ein wichtiger Schritt, um mit attraktiven Radwegeverbindungen für das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag zu werben. Das ist gut für das Klima, die eigene Gesundheit und nicht zuletzt auch den Tourismus in der Region.“
„Das Fahrrad ist als Fortbewegungsmittel zwischenzeitlich nicht mehr wegzudenken und es ist auch schon ein Teil der Alltagsmobilität. Im Pendlerverkehr sind längere Strecken durch Pedelecs und E-Bikes zwischenzeitlich auch keine Hürde mehr, so dass eine gute Radverkehrsmobilität basierend auf einer integrierten Radwegeplanung ein Gewinn an Lebensqualität in und ein Standortfaktor für die Region ist. Mit dem Radnetz OWL gehen wir in die richtige Richtung. Es freut mich, dass unsere gemeinsame Bestrebung, die große Zahl der Pendlerverkehre in der Region nachhaltiger zu gestalten und die effektive Erreichbarkeit ländlicher Gebiete durch multimodalen Verkehr zu ermöglichen, nun mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird.“ So Oberbürgermeister Pit Clausen, Stadt Bielefeld.
Landrat Jürgen Müller, Kreis Herford, freut sich: „Ich freue mich ganz besonders über die Auszeichnung ‚Deutscher Fahrradpreis 2022‘, denn mit dem Radnetz OWL gewinnt das ‚Wir‘: Kooperativ hat die OWL-Region eine Strategie erarbeitet, die einen Rahmen für die Detailplanungen vor Ort bildet. Mein Dank gilt allen an diesem Prozess Beteiligten. Der Preis ist zugleich auch ein Indiz für Politik und Öffentlichkeit, dass die Mobilitätswende in ganz OWL Fahrt aufnimmt.“
Landrat Sven-Georg Adenauer, Kreis Gütersloh: „Mit dem Radnetz OWL haben wir gemeinsam als Region einen weiteren Grundstein für eine klimafreundliche Mobilität gelegt. Unser Ziel ist es, mit sicheren und direkten Alltagsradwegen das Fahrrad zur attraktiven Alternative zum Auto zu machen. Die Auszeichnung beweist: Wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Aufgabe ist es nun, zusammen mit dem Land NRW das Radnetz weiter auszubauen und an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anzupassen.“
Landrat Michael Stickeln, Kreis Höxter: „Unser Kreis Höxter ist fahrradbegeistert. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fahrradpreis ist deshalb eine große Freude und gleichzeitig auch ein Auftrag an alle Beteiligten des Radnetz OWL, den erfolgreichen gemeinsamen Weg weiterzugehen. Denn auch Radlerinnen und Radler benötigen gute Infrastruktur, die nicht an Kreisgrenzen enden darf."
„Innerhalb der REGIONALE 2022 wollen eine neue vernetzte Mobilität auch im ländlich geprägten Raum umsetzen. Dabei soll das Fahrrad für den Pendlerverkehr eine wichtige Rolle übernehmen. Das geht dank neuer E-Bike-Technologie auch über weitere Distanzen und in topografisch schwierigem Gelände. Mit einem Pendler-Radnetz über die Gemeindegrenzen hinweg entsteht ein echtes Angebot, um auch ohne eigenes Auto gesund und individuell mobil zu sein,“ freut sich Annette Nothnagel, Leiterin REGIONALE 2022 bei der OWL GmbH, die digital der Preisverleihung zugeschaltet war.
Hintergrund Radnetz OWL
Die Bedingungen für den Radverkehr heute sind in OstWestfalenLippe sehr unterschiedlich. Vor allem die verdichteten Räume mit den Städten Bielefeld, Paderborn und Gütersloh weisen hohe Radverkehrsanteile auf, aber auch Kommunen im Westen von OWL. Generell sind dichte Netze für den Freizeitradverkehr vorhanden, der Alltagsradverkehr steht aber bisher oft nicht im Fokus. Das im Frühjahr 2021 veröffentlichte Radnetz OWL steht für die Umsetzung eines lückenlosen, verkehrssicheren regionalen Alltagsradwegenetzes.
Hintergrund Der Deutsche Fahrradpreis – best for bike
Als Bestandteil des Nationalen Radverkehrsplans der Bundesregierung trägt Der Deutsche Fahrradpreis dazu bei, Good-Practice-Beispiele bei Entscheidungsträgern und Fachleuten bekannt zu machen. So dienen die eingereichten Beiträge bundesweit als Vorbild und Anregung für weitere Projekte und Maßnahmen der Radverkehrsförderung. Ein weiteres Ziel des Wettbewerbs ist es, das Image des Fahrrads in der Öffentlichkeit aufzuwerten und somit mehr Menschen in Deutschland zum Fahrradfahren zu bewegen.
Pressematerial (PI und Bilder) zum Download: https://www.urbanland-owl.de/presse-und-medien/presseinformationen/

Den offiziellen Spatenstich für den Akzelerator.OWL auf dem Gelände der Barker Barraks in Paderborn führten sie gemeinsam durch: Rene Konrad (Geschäftsführer List Bau Bielefeld), Prof. Dr. Rüdiger Kabst, Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies, Bürgermeister Michael Dreier, Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Vizepräsidentin Simone Probst (Universität Paderborn) und Prof. Dr. Sebastian Vogt.
Mit einem symbolischen Spatenstich ist im Februar 2022 der offizielle Startschuss für den Bau des Akzelerator.OWL gefallen. Die hochmoderne Immobilie der Universität Paderborn auf dem ehemaligen Gelände der Barker Barracks soll der Start-up-Szene in Ostwestfalen-Lippe ein neues Zuhause werden. Auf rund 7.000 m² entstehen Arbeitsräume, ein Maker Space, Werkstätten, Co-Working-Flächen und eine Bürolandschaft für die Mitglieder des Technologietransfer- und Existenzgründungs-Centers der Universität (TecUP). Das mit rund 23 Millionen Euro vom Land geförderte Bauprojekt zielt auf die nachhaltige Stärkung der Gründungskultur in Paderborn und darüber hinaus ab. Stadt und Universität arbeiten bei dem REGIONALE 2022-Projekt Hand in Hand. Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist für das kommende Jahr geplant.
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, der als Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen an der Veranstaltung teilnahm, stellte die Bedeutung einer starken Start-up-Landschaft für die Region heraus: „Die Universität Paderborn gehört mit ihrem erfolgreichen Exzellenz Start-up Center schon heute zur Spitzengruppe der gründungsstarken Universitäten in Deutschland. Mit dem Akzelerator.OWL wird bald eine weitere Top-Adresse hinzukommen. Es liefert die ideale Infrastruktur, um junge Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg bestmöglich vorzubereiten und damit mehr erfolgreiche Hochschulausgründungen hervorzubringen. Mit diesem Gründergeist wird Paderborn seine Position als Leuchtturm des Start-up Ökosystems in Nordrhein-Westfalen weiter festigen.“
Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf bekräftigt: „Die Kombination von Spitzenforschung, die Förderung von Start-ups und die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft setzen regional und überregional Maßstäbe. Der Akzelerator ist nicht nur für die Universität, sondern auch für die gesamte Region OWL ein Vorzeigeprojekt. Ich freue mich sehr über diesen eindrucksvollen Erfolg, zu dem ich allen Beteiligten herzlich gratuliere.“
Auch Michael Dreier, Bürgermeister der Stadt Paderborn, ist stolz auf das Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft: „Der Akzelerator ist die Initialzündung für die Entwicklung unseres neuen, innovativen Stadtteils. Damit zeigt unsere Stadt einmal mehr, wie wichtig ihr die „Start-up-Szene“ für die Zukunft ist“, so Paderborns Bürgermeister. Die Zukunftsschmiede gebe dem Paderborner Zukunftsquartier an der Driburger Straße entscheidende Impulse und trage dazu bei, dass hier tatsächlich ein Stadtquartier von morgen entstehe.
Simone Probst, Vizepräsidentin der Universität Paderborn: „Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, den Akzelerator auf den Konversionsflächen zu realisieren. Wir sind dankbar, so einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten zu dürfen.“
„Wir freuen uns, dass wir für die Universität Paderborn hier ein echtes Leuchtturmprojekt umsetzen können“, betont René Konrad, Geschäftsführer des ausführenden Generalunternehmens LIST Bau Bielefeld. Start-ups, Forschende und Lehrende des TecUP sollen in dem Akzelerator künftig unter einem Dach zusammenarbeiten. Zudem werden Arbeitsflächen in Kooperation mit dem Start-up-Inkubator garage33 geschaffen. Prof. Dr. Sebastian Vogt und Prof. Dr. Rüdiger Kabst, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des TecUP, erläutern: „Als nächste Wachstumsstufe unseres Start-up-Inkubators garage33 legen wir mit dem Akzelerator.OWL heute den Grundstein für den Aufbau eines Start-up Campus OWL“, so Vogt. „Innovative Ausgründungen aus der Wissenschaft tragen signifikant zum Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum in der Region und darüber hinaus bei. Mit dem Exzellenz Start-up Center.OWL und dem Akzelerator.OWL entsteht in Paderborn ein zukunftsweisendes Start-up Ökosystem“, ergänzt Kabst.
„Auf 54 Hektar entsteht hier mit dem Zukunftsquartier ein neues Stück Stadt in der Nähe von Dom und Universität. Die Ansiedlung des Akzelerators.OWL gibt einen herausragenden Entwicklungsimpuls und bietet Spielraum für die wachsende Universität und Gründungsszene in Paderborn. Ich freue mich, dass dieser beispielgebende Think Tank als Projekt der REGIONALE mit dem Spatenstich heute in die Umsetzung geht“, hebt Annette Nothnagel, Leiterin der REGIONALE 2022 bei der OWL GmbH hervor. Die OWL GmbH richtet das NRW-Strukturprogramm unter der Überschrift „UrbanLand“ aus. Ziel ist es, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land über innovative und modellhafte Projekte zu stärken. Um die Qualität der Vorhaben zu gewährleisten, durchlaufen Projektideen für Ostwestfalen-Lippe ein dreistufiges Qualifizierungsverfahren. Der Azelerator.OWL ist eines von aktuell 44 REGIONALE-Projekten.
Alle Informationen zum REGIONALE-Projekt Akzelerator.OWL auf der Projektseite.

Das Förderprogramm "Aufsuchende Stabilisierungsberatung" geht in OWL in vier Regionen an den Start, um Langzeitarbeitslose und ihre Arbeitgeber gezielt zu unterstützen.
Die Pandemie hat die Situation vieler Menschen auf dem Arbeitsmarkt erschwert. So ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen und umfasst über 300.000 Menschen.
Aus diesem Grund hat das Land mit Mitteln der Initiative REACT-EU das Programm „Wiedereinstieg“ aufgelegt. Verschiedene Angebote helfen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt und schaffen neue Beschäftigungsperspektiven. Die „Aufsuchende Stabilisierungsberatung“ geht dabei einen anderen Weg, wie Arbeitsminister Karl-Josef Laumann erklärte:
Die Pandemie soll soziale Gräben nicht noch größer machen. Daher wollen wir gezielt die Menschen unterstützen, die lange arbeitslos waren und nun eine Chance bekommen zu arbeiten. Mit der aufsuchenden Stabilisierungsberatung machen wir Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein Beratungsangebot, damit aus der Chance auf Arbeit eine langfristige Beschäftigung werden kann.
Viele Beschäftigungsverhältnisse von eingegliederten Langzeitarbeitslosen enden vorzeitig und sie drohen wieder in den Leistungsbezug zurückzufallen.
Mit der „Aufsuchende Stabilisierungsberatung“ soll dies verhindert werden. Wenn nach der Aufnahme der Beschäftigung der Kontakt zum Jobcenter oder der Agentur für Arbeit abgebrochen wurde, soll mit einem aufsuchenden Ansatz der Vermittlungserfolg erhalten werden.
Dabei werden sowohl die ArbeitnehmerInnen als auch die ArbeitgeberInnen angesprochen, um frühzeitig Probleme zu erkennen und zu lösen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das Arbeitsverhältnis abgebrochen wird bzw. eine Kündigung erfolgt.
Bei der individuellen Beratung durch die regionalen Beratungsstellen können innerbetriebliche, aber auch persönliche Probleme angegangen werden.
Einerseits können durch Coachings Schlüsselkompetenzen für den Beruf erlernt werden oder aber mit dem Aufbau einer Tagesstruktur das soziale Umfeld um die Arbeit gestärkt werden.
In Ostwestfalen übernehmen vier Träger diese Aufgabe in den Regionen, die für weitere Informationen angesprochen werden können:
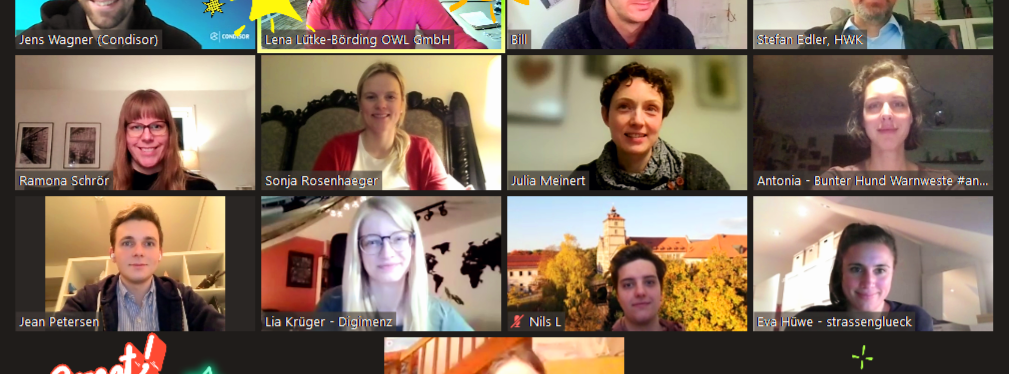
startklar Themenspecials sind gut besucht
Donnerstag Abend ungefähr halb zehn in einer digitalen Wolke in OstWestfalenLippe...
Über 30 Mitglieder unserer startklar-Teams sind fit und motiviert, um Stefan Edler von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld bei seinem super Input zum Thema Kundengewinnung und Kundengewinnung zu lauschen und die Gelegenheit zu nutzen ihre Gründung auf Erfolgskurs zu bringen. Anna-Lena Lütke-Börding, Projektverantwortliche des startklar Businessplanwettbewerbs, moderierte und organisierte die Veranstaltung.
Den Input "kundengewinnung und Kundnebindung" haben wir bereits im Rahmen der Gründerinnenakademie OWL angeboten und er ist nach wie vor Gold wert! Und so wie die Arbeit im Marketing, die sich regelmäßig mit den Veränderungen des Marktes und der Zielgruppe auseinander setzen muss, so wird auch dieses Seminar immer wieder angepasst und weiter entwickelt. Tolle Arbeit!
Am Ende des Abends haben die Teams einen fundierten Einblick in das Thema Marketing gewonnen und wissen nun, dass es dabei bei weitem nicht nur um Werbung geht. Tipps und Tricks inklusive - Herzlichen Dank dafür !
Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld ist übrigens Mit-Sponsor von startklar. Und weil einige unserer Sponsoren über viel Expertise im Bereich Gründung verfügen und diese gerne teilen, treffen die Teams sie in einigen Workshops als Referent*innen an und profitieren so von dem geballten Know-How aus OWL - einfach toll- vielen Dank an dieser Stelle: Sparkasse Paderborn-Detmold | Sparkasse Bielefeld - GründerCenter und alle Sparkassen in OWL | BDO | HLB Stückmann | IHK Ostwestfalen zu Bielefeld | IHK Lippe zu Detmold | IKK classic | Schüco International KG | WAGO | Wortmann & Partner & Co. KG
Weiter geht es am 01. Februar mit dem Special "Social Media Marketing-Strategie" mit Thorsten Ising. Das Seminar ergänzt den Input von gestern perfekt. Wir freuen uns schon drauf und bedanken uns bei allen Teams für die rege Teilnahme an den Workshops.
Und um die digitale Wolke mal ein klein wenig weg zu schieben, haben wir diesmal ein bisschen Sonne mit ins Spiel gebracht :) 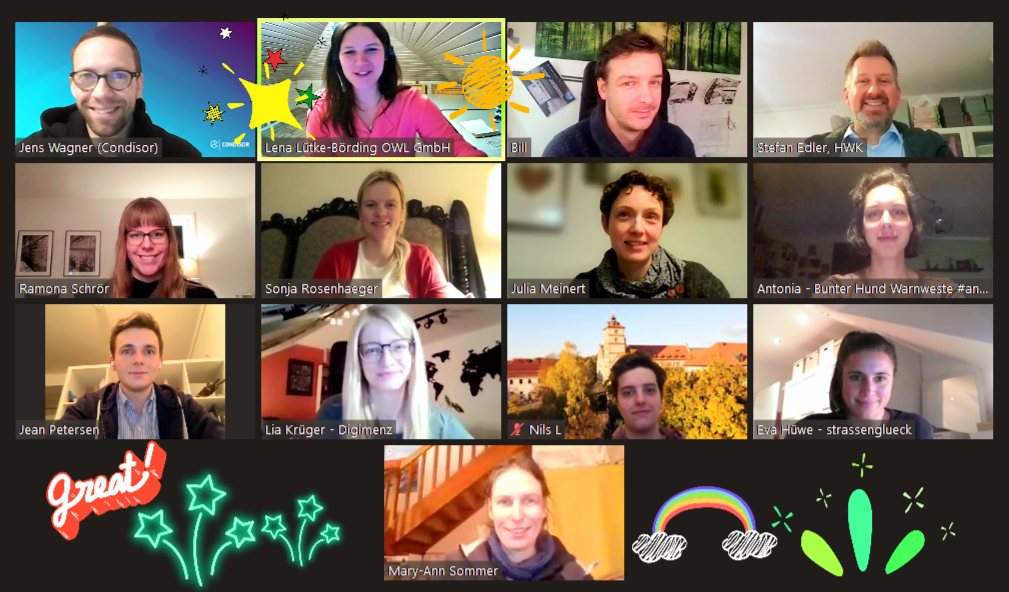
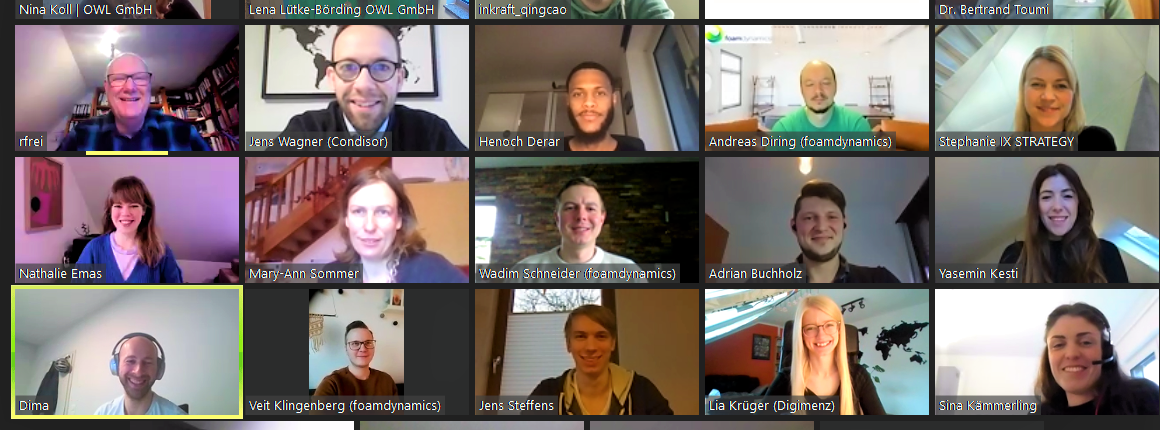
Businessplanwettbewerb startklar startet mit voller Energie ins Jahr 2022
OstWestfalenLippe sprüht voll innovativem Gründungsgeist - kreativ, innovativ und divers - so kann man die bunte Mischung an Teams des diesjährigen startklar-Businessplan Wettbewerbs wohl bezeichnen. Neben den Preisen von bis zu 10.000 € bietet der Wettbewerb vor allem einen ganz besonderen Mehrwert: Zugang zu einem vitalen und wachsenden Gründungsökosystem OWL und zu vielen anderen kreativne und spannenden Gründerinnen und Gründern, die sich auf den Weg machen ihre Gründungsidee in die Tat umzusetzen!
Was für Synergien, neue und künftige Geschäftsbeziehungen und weiterer Mehrwert sich daraus ergibt bleibt unserem Auge zwar vorerst verborgen, direkt zu erkennen ist für uns aber die großartige Offenheit und die Wertschätzung mit der sich die Teams in diesem Wettbewerb begegnen. Am 07. Janunar konnten wir wieder Zeuge von diesen großartigen Eigenschaften von Gründerinnen und Gründern werden.
Inspirierend und wertvoll war die Veranstaltung, die von Anna-Lena Lütke-Börding, Projektmanagerin des startklar Wettbewerbs bei der OstWestfalenLippe GmbH moderiert und begleitet wurde. Wer Lust hatte konnte in entspannter Atmosphäre seine oder ihre Gründungsidee in Breakoutsessions pitchen, Fragen zum weiteren Ablauf des Wettbewerbs stellen und sich mit den anderen Gründerinnen und Gründern über Fragen und Themen zur Gründung austauschen. Der Austausch wird auch außerhalb des Wettbewerbs fortgeführt, wie uns die Teams erzählen - das nennen wir nachhaltig! Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung am Montag, den 17, Januar, bei der es um die Verschriftlichung des Businessplans geht.
Impression des Tages: 

Der Wettbewerb 2021/22 läuft seit etwa einem Monat – eine gute Zeit also für einen kleinen Rück- und Ausblick.
Ein eigenes Unternehmen gründen – gar nicht so einfach. Für das Innovationsökosystem der Region OstWestfalenLippe sind frische Köpfe mit guten Ideen jedoch ungemein wichtig. Der Businessplan-Wettbewerb startklar hat daher zum Ziel, Unternehmensgründer:innen auf dem Weg zur eigenen Firma zu unterstützen, und bereichert die Region so mit einer starken Gründerszene. Der Wettbewerb 2021/22 läuft seit etwa einem Monat – eine gute Zeit also für einen kleinen Rück- und Ausblick.
Am 15. November fiel der Startschuss mit einem ersten Netzwerk-Treffen am Paderborner Sitz der Sparkasse Paderborn-Detmold. Etwa 60 Teilnehmer:innen kamen zusammen, um den Auftakt zum Wettbewerb zu feiern und sich bei einem kleinen Imbiss kennenzulernen. Schnell wurde deutlich: Hier entsteht ein Netzwerk, dass die Gründer:innen noch lange begleiten wird. Auch einige der Lots:innen waren dabei (siehe Foto unten). Jedes Team bekommt Lots:innen zugeteilt, die in den kommenden Monaten als niedrigschwellig erreichbare Ansprechpersonen fungieren. Bei jeder Frage, die im Gründungsprozess aufkommt, wissen sie entweder gleich selbst die Antwort, oder können an die jeweiligen Experten verweisen. So wird sichergestellt, dass alle Teams mitgenommen werden und einen unkomplizierten wie hochwertigen Zugang zu Informationen und Insider-Wissen haben. |
|
| Neben den Lots:innen besteht in den regelmäßigen Workshops eine weitere Möglichkeit, Know-How aufzubauen. Für viele neue Unternehmen und vor allem Start-ups ist die Prototypen- und Produktentwicklung zunächst zentral. Neben ersten Marketing- und Vertriebsaktivitäten liegt hier am Anfang oft der Fokus. Nicht aus den Augen verloren werden dürfen dabei allerdings finanzielle und juristische Fragen. Welche Unternehmensform bietet sich an? Wie werden Umsätze richtig versteuert? Wie sieht eine gesunde Finanzplanung aus? Antworten auf diese und weitere Fragen sind Teil der vielfältigen Veranstaltungen, zu denen startklar-Teilnehmer:innen Zugang bekommen. |
So drehte sich etwa im ersten von vier Businessplan-Workshops am 20. November alles um das Thema „Angebot und Nachfrage“. Nicolas Megow, Spezialist für Lean Start-up, erläuterte hier in der Founders Foundation in Bielefeld Grundlagen und Methoden, Angebot und Nachfrage effektiv zusammenzuführen. Dabei ging er auf viele Aspekte rund um die Entwicklung und Verwerfung eines Angebotes, aber vor allem auch auf die Relevanz der kontinuierlichen Anpassung des Angebots auf Grundlage von Erfolgsmessungen ein. Weiterhin wurden Tools und Zeitpläne vorgestellt, mit denen die Gründer:innen ihr Angebot auf die Nachfrage abstimmen können (Foto: Jana Gerdes (WEGE Bielefeld), Anna-Lena Lütke-Börding (OstWestfalenLippe GmbH) und Janina Ostendorf (Founders Foundation)). Am 11. Dezember ging es um die Entwicklung von Prototypen und die Preisgestaltung. Wenn neue Unternehmen in einen bestehenden Markt eintreten, besteht in der Bestimmung eines angemessenen Preises für Produkt oder Dienstleistung ein Gang auf Messers Schneide: Setzt man zu tief an, können die eigenen Kosten u.U. nicht gedeckt werden – bei einer nachträglichen Anhebung des Preises könnten erste Kunden verloren gehen. Setzt man indes zu hoch an, steigt die Hürde für potenzielle Kunden, dem neuen Akteur am Markt eine Chance zu geben. Damit die Teilnehmer:innen von startklar hier eine klare Richtschnur an die Hand bekommen, erarbeiteten sie mit Nicolas Megow erste geeignete Preise für ihre prototypischen Angebote. Etwa 30 Gründer:innen waren dabei (siehe Foto unten). |
|
| Während der Wettbewerb damit für das restliche Jahr 2021 eine Winterpause einlegt, geht es 2022 fulminant weiter. Mit einem Netzwerktreffen, dem dritten Businessplanworkshop und zwei Themenspecials ist der Januar bereits vollgepackt mit spannenden Veranstaltungen, die für jede:n Gründer:in wichtig sind. So drehen sich die Specials etwa um die Kundengewinnung und die sozialen Medien als Marketingwerkzeug – im digitalen Zeitalter zwei Themen, die fest zusammengehören. Hier können sich die Teams auf Inputs von Stefan Edler (Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld) und Thorsten Ising (selbständiger Online-Marketing- & Social-Media-Manager) freuen. Wir können gar nicht erwarten, zu sehen, was für tolle Unternehmen die Gründer:innen auf die Beine stellen werden, und halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden! Übrigens können nach wie vor noch neue Teams einsteigen. Einfach anmelden unter www.startklar-owl.de. |

Freuen sich über drei ausgezeichnete Innovationen beim OWL-Innovationspreis 2021/22 (v.l.): Jürgen Noch (Geschäftsführer Westfalen Weser Energie), Wolfgang Marquardt (Prokurist OstWestfalenLippe GmbH) Petra Pigerl-Radtke (Hauptgeschäftsführerin IHK Ostwestfalen), Rainer Müller (Geschäftsführer Stadtwerke Bielefeld) und Robert Kröger (Projektleiter OstWestfalenLippe GmbH).
Bielefeld, 17. Dezember 2021. Die drei Gewinner des OWL-Innovationspreis MARKTVISIONEN 2021/2022 der OstWestfalenLippe GmbH stehen fest. Die DENIOS AG aus Bad Oeynhausen überzeugte die Jury in der Kategorie „Marktvisionen“ mit einer digitalen Lösung für eine sichere Gefahrstofflagerung. Die Paderborner ENERVATE GmbH erhält den Preis in der Kategorie „Zukunft gestalten“ für eine intelligente Thermofassade, mit der Bestandsgebäude den Energieeffizienz-Standard von Neubauten erreichen können. Der Start up-Preis für eine erfolgversprechende Unternehmensgründung geht an die CodeShield GmbH, die eine Software für eine sichere Datenspeicherung in der Cloud entwickelt hat, die Unternehmen vor Hacker-Angriffen schützt. Der Start-up-Preis ist dotiert mit einem Preisgeld von 5.000 € und einem Beratungspaket. Hauptförderer des Wettbewerbs sind die Stadtwerke Bielefeld und Westfalen Weser Energie.
93 Unternehmen hatten sich mit 94 innovativen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen für den renommierten Wirtschaftspreis beworben, der bereits zum 14. Mal ausgeschrieben wurde. „Die große Resonanz macht die enorme Innovationskraft unserer heimischen Unternehmen sichtbar und zeigt die Akzeptanz des Wettbewerbs in der Wirtschaft. Aus den Bewerbungen wird deutlich, dass sich Unternehmen aus OWL mit ihren Innovationen erfolgreich auf den Märkten behaupten und Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft entwickeln. Die hohe Zahl von 36 Bewerbungen um den Start-up-Preis demonstriert die hohe Gründungsdynamik in OWL“, freut sich Wolfgang Marquardt, Prokurist der OstWestfalenLippe GmbH.
Die Bewerbungen decken die Branchenvielfalt der Region ab. Das Spektrum reicht von neuen Fertigungsverfahren, Werkstoffen und Assistenzsystemen über Software für maschinelles Lernen und Prozessoptimierung bis zu innovativen Möbeln und Gebäudetechnologien. Darüber hinaus geht es um die Förderung von Gesundheit, Elektromobilität und Nachhaltigkeit.
„Die Gewinner demonstrieren, wie durch das Zusammenspiel von Ingenieurskunst, Anwenderwissen und Informatik Innovationssprünge entstehen. Sie haben Beharrlichkeit in der Entwicklung gezeigt, sind mutig neue Wege gegangen und haben sich Wissen in Kooperationen mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen erschlossen. So haben sie einzigartige Lösungen in den Bereichen Gefahrstofflagerung, Gebäudesanierung und IT-Sicherheit entwickelt, mit denen sie die nationalen und internationalen Märkte erobern werden. Die Gewinner stehen für Hightech-Produkte, mit denen sich auch kleine Unternehmen zu Technologieführern entwickeln“, berichtet Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwestfalen und Sprecherin der Jury. „Die Qualität der Bewerbungen war sehr hoch und hat der Jury die Entscheidung in diesem Jahr wieder einmal sehr schwer gemacht. Das zeigt, was für innovative oder großartige Unternehmen wir in OWL haben“, ergänzt Pigerl-Radtke.
Höchste Sicherheit für Beschäftigte und Umwelt
In Unternehmen ist die Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen, wie beispielsweise entzündlichen und giftigen Chemikalien, mit Risiken für die Umwelt und die Gesundheit der Beschäftigten verbunden. Diese Gefahrstoffe werden daher in speziell ausgewiesenen Gefahrstofflagern aufbewahrt. Dabei kommt es immer wieder zu Mängeln wie dem Austreten von Gefahrstoffen, Bränden oder Explosionen. Das führt zu erheblichen Schäden. So hat sich das Volumen der durch Unfälle freigesetzten Schadstoffe in 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, die Anzahl der meldepflichtigen Unfälle ist um 23 % gestiegen. Die Kosten durch Produktionsausfälle und Stillstandzeiten sind häufig noch höher als durch den Schaden selbst.
Der DENIOS AG ist es als erstem Anbieter weltweit gelungen, die Gefahrstofflagerung zu digitalisieren. Die Lösung DENIOS connect verbindet einen Überwachungssensor für Gefahrstoffe mit einer cloudbasierten Webapplikation. Dadurch ist eine permanente Überwachung der Status-Daten der Gefahrstofflager möglich. Veränderungen in der Temperatur oder der Gaskonzentration sowie Leckagen werden frühzeitig erkannt, sodass drohende Schäden minimiert oder verhindert werden können. Der bzw. die Verantwortliche im Unternehmen wird dann per SMS oder E-Mail auf seinem Endgerät gewarnt. Darüber hinaus erfolgt vor Ort ein optischer und akustischer Alarm.
Grundlage für die Innovation war eine intensive Kooperation mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Rahmen des Spitzenclusters it´s OWL. Die Lösung findet schon jetzt eine hohe Nachfrage auf dem Markt und wird von renommierten Unternehmen in den Bereichen Chemie, Maschinenbau und Automobilzulieferer eingesetzt. Ein besonderes Plus: DENIOS connect kann herstellerunabhängig eingesetzt und für die Nachrüstung von Gefahrstofflagern anderer Anbieter genutzt werden. Dadurch erwartet DENIOS erhebliche Umsatzsteigerungen. Die Innovation hat eine hohe strategische Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Unternehmens. Perspektivisch sollen rund 30% des Umsatzes mit der Innovation generiert werden.
Pigerl-Radtke erläutert: „DENIOS ist nach Ansicht der Jury in langjähriger Entwicklungsarbeit ein Innovationssprung gelungen, mit dem das Unternehmen neue Standards für die sichere Gefahrgutlagerung liefert. Die Lösung überzeugt mit einem Gesamtkonzept aus Produkt, Webanbindung, Smart Service und Vernetzung. Durch die Kooperation im Spitzencluster wurde Wissen aus der Forschung für ein völlig neues Konzept verfügbar gemacht, das in umfangreichem Maße Daten ermittelt und auswertet. Die Bewerbung zeigt, wie ein Unternehmen sein Geschäftsmodell konsequent digitalisiert. Die Jury ist überzeugt, dass das Unternehmen mit DENIOS connect seinen Umsatz erheblich steigern und neue Märkte erschließen wird. Und gleichzeitig vielen anderen Mittelständlern ein Vorbild für die digitale Transformation ihrer Geschäftsmodelle ist.“
Die Fußbodenheizung an der Hauswand
Privathaushalte gehören neben Verkehr, Industrie und Gewerbe zu den größten Energieverbrauchern in Deutschland. 75% der im Haushalt genutzten Energie entsteht dabei dadurch, dass Räume beheizt oder gekühlt werden. Energieeinsparungen in diesem Bereich haben daher eine große Wirkung für die Reduktion des CO2-Ausstoßes und das Erreichen der Klimaziele. Derzeit liegt die Sanierungsquote von Bestandsgebäuden aber lediglich bei 0,2 %, so dass die Dekarbonisierung des Gebäudesektors in der EU 500 Jahre dauern würde.
Vor diesem Hintergrund hat sich das Team von ENERVATE das Ziel gesetzt, die Energieeffizienz von Bestandsgebäuden zu verbessern. Mit den eigens entwickelten Thermomodulen können Altbauten energetisch so saniert werden, dass sie den Energieeffizienz-Standard eines Neubaus erreichen. Dabei muss nicht in den Wohnraum eingegriffen werden. Die Thermomodule werden an der Außenwand des Hauses angebracht und funktionieren nach dem effizienten Prinzip einer Fußbodenheizung: Die Thermofassade heizt die gesamte Fassade des Hauses gleichmäßig auf und nutzt die Wände als Wärmespeicher. So wird eine gleichbleibende Grundtemperatur im gesamten Haus erzeugt, die auch das Schimmelrisiko erheblich reduziert. Die individuelle Temperatur kann durch das bestehende Heizsystem reguliert werden.
Die Thermomodule bestehen aus Stahlblech und Heizrohren, die zwischen die Altbauwand und einer klassischen Dämmung installiert werden. Dabei werden nachhaltige Materialien genutzt, die auch recycelt werden können. Das System ist einfach zu bedienen und wartungsarm. Über eine intelligente Steuertechnik soll in Zukunft überschüssige Energie aus erneuerbaren Energien für die thermische Speicherung genutzt werden, die börsenpreisoptimiert vom Strommarkt bezogen werden kann. Darüber hinaus wird mithilfe einer Software ein digitaler Zwilling des Gebäudes erzeugt, um das Sanierungsvorhaben optimal und effizient zu planen. Erste Pilotprojekte werden bereits in der Region umgesetzt. Die Nachfrage nach der Thermofassade ist bundesweit hoch. Das Markpotenzial ist enorm: Allein in Deutschland müssen bis zum Jahr 2050 32 Millionen Wohneinheiten saniert werden.
„ENERVATE zeigt, wie Altbauten einfach saniert und hochwertige Energieeffizienz-Standards erreicht werden können. Die Jury lobt den Mut, die Beharrlichkeit und den Pioniergeist, mit dem das junge Team die große gesellschaftliche Herausforderung Klimaschutz angeht“, unterstreicht Jurymitglied Rainer Müller, Geschäftsführer Stadtwerke Bielefeld. „Vor dem Hintergrund einer politischen Aufbruchstimmung kommt die Innovation zur richtigen Zeit. ENERVATE zeigt, wie aus innovativen Netzwerk- und Forschungsprojekten praxisnahe und kreative Lösungen entstehen. Und wie sich Ingenieurskunst und Nachhaltigkeit verbinden lassen. Laut Ansicht der Jury ist das junge Unternehmen ein Leuchtturm, um aus OstWestfalenLippe heraus einen wichtigen Beitrag für die Einsparung von CO2 und energieeffizientes Wohnen zu leisten,“ so Müller weiter.
Daten einfach vor Hackern schützen
Umfragen zeigen, dass über 80% der Unternehmen in Deutschland eine Cloud für die Speicherung von Daten nutzen – Tendenz steigend. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Hackerangriffe dramatisch zu. Beinahe täglich berichten die Medien über Cyberattacken. Eine zusätzliche Herausforderung besteht in der hohen Geschwindigkeit, mit der sich Cloud-Anwendungen und deren Infrastruktur verändern. Vor diesem Hintergrund ist es Unternehmen nahezu unmöglich, alle Sicherheitsrisiken zu erkennen und sich ausreichend davor zu schützen.
Genau an dieser Stelle setzt die CodeShield GmbH an. Das Paderborner Start-up bietet eine neuartige IT-Security Lösung, die Unternehmen bei der sicheren Entwicklung sowie dem Betrieb von Cloud-Anwendungen unterstützt. Durch den Einsatz von Analyse-Technologien können Sicherheitslücken im Anwendungscode, in Open-Source-Bibliotheken und in der Cloudumgebung automatisiert identifiziert werden. So gelingt es, sowohl falsche Zugriffseinstellungen und unsichere Konfigurationen als auch Softwarepakete frühzeitig zu erkennen, die mit Schwachstellen behaftet oder veraltet sind. Das Analyseverfahren kann auch komplexe Systeme analysieren, ohne dass deren korrekte Ausübung oder Geschwindigkeit beeinflusst wird. Alle relevanten Sicherheitslücken können festgestellt werden, ohne dabei falsche Alarme auszulösen. Dies ist ein entscheidender Mehrwert gegenüber anderen Lösungen auf dem Markt, denn Security Teams in Unternehmen werden häufig mit hunderten oder sogar tausenden Warnungen täglich konfrontiert.
Das System kann zudem erkennen, welche Sicherheitslücken von außen erreichbar sind. Dies ermöglicht eine gezielte Risikoabschätzung und eine Priorisierung der Sicherheitslücken, so dass schnell und effektiv auf die Bedrohungen reagiert werden kann. Die Technologie ist das Ergebnis einer langjähren Entwicklungskooperation zwischen dem Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn und dem Fraunhofer IEM. Seit der Gründung im April 2020 hat das Start-up die Lösung bereits erfolgreich mit Pilotunternehmen evaluiert und tritt jetzt in den Markt ein.
Jurymitglied Jürgen Noch, Geschäftsführer Westfalen Weser Energie erläutert: „CodeShield ist es nach Ansicht der Jury gelungen, Ergebnisse aus der Grundlagenforschung erfolgreich in die praktische Anwendung zu übertragen und eine zentrale Herausforderung für die deutsche Wirtschaft zu lösen: die digitale Souveränität und Sicherheit. Die Jury sieht ein enormes Marktpotenzial. Denn die hoch innovative Lösung kann branchenunabhängig von allen Unternehmen eingesetzt werden. CodeShield ist ein Paradebeispiel für die IT-Kompetenz des Standorts OstWestfalenLippe und demonstriert, wie aus der Forschung innovative Start-ups entstehen.“
OWL Innovationspreis MARKTVISIONEN 2021/2022
Die OstWestfalenLippe GmbH schreibt alle zwei Jahre den OWL-Innovationspreis MARKTVISIONEN aus. Ziel ist es, Innovationen aus der Region ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken und neue Impulse zu geben. Ausgezeichnet werden innovative Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse in ostwestfälisch-lippischen Unternehmen. Hauptförderer des Wettbewerbs sind die Stadtwerke Bielefeld und Westfalen Weser Energie. Durch ihre Beteiligung wollen sie dazu beitragen, die kreativen und innovativen Potenziale in der Region zu stärken und einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Darüber hinaus wird der Wettbewerb unterstützt durch Adam Design (Bielefeld), die Unity AG (Büren) und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh.
Die Mitglieder der Jury
Kontakt
OstWestfalenLippe GmbH
Wolfgang Marquardt
Tel. 0521 9673322
Mobil 0174 7798841
w.marquardtnoSpam@ostwestfalen-lippe.de
www.ostwestfalen-lippe.de
DENIOS AG, Dr. Jan Regtmeier, Director Innovation
Tel. 49 175 117929, jaRnoSpam@denios.de, www.denios.de
ENERVATE GmbH, Jona Vogel, Co-Founder
Tel. 0176 20365296, j.vogelnoSpam@enervate.de, www.enervate.de
CodeShield GmbH, Johannes Späth, Geschäftsführer
Tel. 05251 2972030, johannes.spaethnoSpam@codeshield.io, www.codeshield.io

„Diese Vision, zirkulär zu wirtschaften – also das Ganze nicht nur als grünen Trend zu verstehen, sondern wirklich Wirtschaftswachstum zu erzeugen – und das auf nachhaltige Weise.“ Sven Brüske ist überzeugt: Ohne Kreislaufwirtschaft geht es in Zukunft nicht.
„Diese Vision, zirkulär zu wirtschaften – also das Ganze nicht nur als grünen Trend zu verstehen, sondern wirklich Wirtschaftswachstum zu erzeugen – und das auf nachhaltige Weise.“ Sven Brüske ist überzeugt: Ohne Kreislaufwirtschaft geht es in Zukunft nicht. Als Projektkoordinator betreut er beim Innovationsnetzwerk Energie Impuls OWL das Projekt CirQuality OWL, das die Vorbereitung der Region auf zirkuläres Wirtschaften zum Ziel hat.
Zirkulär zu wirtschaften heißt, bestehende Prozesse und Strukturen, Geschäftsmodelle und vor allem den Materialeinsatz neu und nachhaltig zu denken. Bestenfalls bleiben so viele bereits verwendete Rohstoffe im Wertstoffkreislauf, dass keine neuen Rohstoffe verbraucht werden müssen. Es entsteht eine Wirtschaft, die den gesamten Lebenszyklus eines Produktes begleitet und etwa verschrottete Waschmaschinen in ihre Einzelteile zerlegt, ihre Bestandteile wieder der Produktion zuführt und ihnen ein zweites, drittes und viertes Leben einhaucht. CirQuality OWL soll das Know-How über zirkuläres Wirtschaften in der Region stärken und ein Netzwerk für Erfahrungsaustausch, Diskussion und Wissenstransfer aufbauen. „Wir wollen die Unternehmen in allen Bereichen dazu befähigen, an der Circular Economy, an der zirkulären Wertschöpfung arbeiten zu können“, bringt Sven Brüske das Projektziel auf den Punkt. Im Ökosystem aus Unternehmen, Politik, Hochschulen und Gesellschaft werden die Akteure qualifiziert und strategisch unterstützt.
„Zu Beginn mussten wir den Begriff Circular Economy oftmals noch erklären – das hat sich innerhalb kürzester Zeit geändert.“
Als das Projekt vor zwei Jahren startete, war zirkuläres Wirtschaften ein eher „grünes Thema“, das bei den meisten Unternehmen keine Priorität genoss. Schließlich prasselten doch auf viele Mittelständler und Konzerne schon genügend andere Herausforderungen ein. So mussten die Projektmitarbeiter:innen und Expert:innen von CirQuality OWL im Kontakt mit den Betrieben oftmals bei null anfangen und zunächst ein Grundverständnis für zirkuläres Wirtschaften aufbauen – Sven Brüske verschlagwortet diesen Prozess unter „Capacity Buildung“. Den Unternehmen musste vielfach das hohe Potenzial dargelegt werden, das über ein ideelles Interesse an Nachhaltigkeit hinausgeht und wirtschaftlichen Nutzen verspricht. Die Reaktionen: Oftmals eher zurückhaltend. Es brauchte Zeit und Überzeugungsarbeit, um zu erkennen, dass Circular Economy kein kurzfristiger Trend ist. Inzwischen sind Brüske und sein Team selbst überrascht, in welcher Geschwindigkeit das Thema Fahrt aufgenommen hat.
„Das ist kein reines grünes Thema, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit.“
Um Circular Economy anzugehen, „gehört unternehmerischer Mut an der ein oder anderen Stelle dazu“, berichtet Brüske. Für viele Unternehmen wird es inzwischen allerdings wirtschaftlich notwendig. Denn gerade 2021 hat sich gezeigt, dass Rohstoffe knapper werden, nicht lieferbar sind oder sich stark verteuern. Insbesondere bei Elektrobauteilen kann der Mangel schon heute die Produktion beeinträchtigen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist abhängig von importierten Rohstoffen, wodurch heimische Unternehmen Engpässe sehr deutlich spüren. Steigt der Grad der Wiederverwertung bereits im Land befindlicher Stoffe, sinkt die Abhängigkeit von langen Lieferketten – Unternehmen werden somit resilienter.
Die Vorteile, die zirkuläres Wirtschaften verspricht, sind aus rein unternehmerischer Sicht bereits überzeugend. Hinzu kommen politische Vorgaben: Die EU legt mit dem Green Deal immer schärfere Vorgaben für Recyclingquoten und den Einsatz von zirkulär gewonnenem Material vor. Und auch beim Verbraucher hierzulande wächst das Interesse an nachhaltig hergestellten Gütern. Gleichzeitig stellt das unglaublich komplexe Thema gerade kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen: Wie und wo kann angefangen werden? Welche Akteure aus welchen Bereichen müssen mit ins Boot geholt werden? Klar ist: Um ein Produkt „from the cradle to the grave“, also über seinen gesamten Lebenszyklus mit Zirkularität im Hinterkopf begleiten zu können, müssen zahlreiche Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette an einem Strang ziehen.
„Ostwestfalen-Lippe ist der perfekte Nährboden.“
CirQuality OWL hat das Thema für Ostwestfalen-Lippe in den Fokus gerückt und erzeugt damit positive Resonanz inner- und außerhalb der Region: „Ostwestfalen-Lippe und Circular Economy – das hören wir häufig, dass das im Kontext steht“, berichtet Brüske. Unternehmen wie Windmöller, Schüco oder ZF Friedrichshafen gehen mit Best Practices voran und zeigen, dass sich ein finanzieller Vorteil – und damit ein Wettbewerbsvorteil – erzielen lässt. Die Voraussetzungen, die es für das zirkuläre Wirtschaften in OWL gibt, stimmen Brüske positiv: „Ein starker Produktionssektor, der aber rohstoffabhängig ist, mit unseren Digitalkompetenzen, mit unserer Hochschullandschaft, mit der Kooperationsbereitschaft zwischen Hochschulen, Unternehmen und Institutionen. Das ist der perfekte Nährboden!“
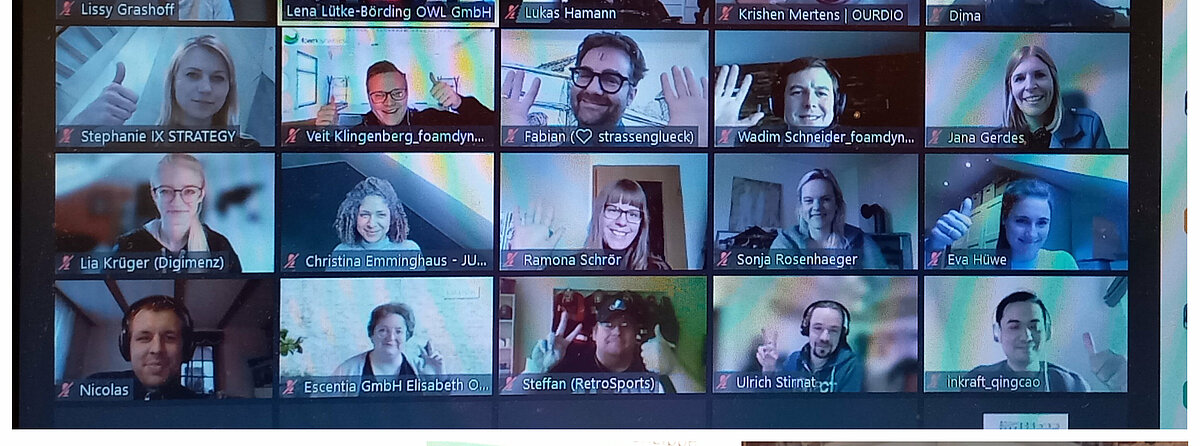
startklar Businessplanworkshop "Preis und Prototypen"
Am Samstag, den 11.12. fand der zweite Businessplanworkshop zum Thema "Preis und Prototypen" statt. Dieses Mal konnten wir 30 Teilnehmende begrüßen. Referent Nicolas Megow führte durch das Seminar.und im Anschluss gab es noch eine kurze online-Führung durch das StartMiUp in Minden mit dem Leiter Jens Walsemann.
Den richtigen Preis für die eigene Dienstleistung oder das eigene Produkt zu finden ist gar nicht so leicht. Neben den Herstellungskosten möchten Gründer und Gründerinnen ja schließlich in Zukunft auch von ihrem Unternhemen leben können. Welche Marge schlage ich also auf mein Produkt? Was nimmt mir die Kundschaft ab und sollte ich vielleicht erstmal meine Leistungen verschenken, um überhaupt Kundschaft zu bekommen? Viele solcher Fragen beschäftigen die Teams. Und nicht nur der Preis, sondern auch der Protoyp ist ein großes Thema: Kann ich erst auf den Markt gehen, wenn mein Produkt perfekt ist? Oder wie stelle ich das an?
Nicolas Megow, Experte für Lean Startup führte die Gründerinnen und Gründer mit vielen praktischen Beispielen und Leitlinien durch die Veranstaltung und gab Antworten und wertvolle Tipps zu den vielen Fragen. Am Ende blieb keine davon offen und die Teams nehmen, neben vielen detailiierten und individuellen Erkenntnissen, mindensten zwei Dinge mit:
1. Ich verschenke nichts und starte auch nicht mit Rabattaktionen, denn mein Produkt, meine Dienstleistung ist etwas wert. Sobald ich einen Kunden oder ein Kundin habe, die den Preis bezahlen möchte, dann lasse ich den Preis natürlich auch bezahlen.
2. Mein erstes Angebot (Protoyp) muss nicht perfekt sein, um auf den Markt zu gehen. Das Produkt entwickelt sich durch stetige Verbesserung, Feed Back und Evaluierung weiter, bis es eines Tages top ist, ganz nach dem Motto: "Wenn Dir die erste Version Deines Produktes nicht peinlich ist, hast Du es zu spät auf den markt gebracht."
Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen. Der 3. Businessplanworkshop findet am 22. Januar von 09:00 -16:00 online via Zoom statt und es geht um das spannende Thema " Markt, Wettbewerb und Markteintritt"
startklar zählt mittlerweile übrigens 75 teilnehmende Teams! Wir freuen uns riesig über die gute Resonanz :)
Hier noch eine Impression des Tages mit einigen der teilnehmenden Teams und Anna-Lena Lütke-Börding, OWL GmbH und Jens Walsemann, Leiter StartMiup
.

Im Mittelpunkt der Dezembersitzung des UrbanLand Board standen Projekte zur Schaffung lebendiger Quartiere in Stadt und Land, von Orten der Begegnung und touristischer Angebote. Mit 44 qualifizierten Projekten und rund 135 Millionen Euro Fördervolumen geht OWL ins finale REGIONALE-Jahr.
Menschen wollen ein attraktives, spannendes und modernes Lebensumfeld – unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben. REGIONALE 2022-Projekte verwirklichen Ideen und Modelle für ein zukunftsfähiges OstWestfalenLippe. Im Mittelpunkt der letzten UrbanLand Board-Sitzung für dieses Jahr standen Projekte zur Schaffung lebendiger Quartiere in Stadt und Land, von Orten der Begegnung und touristischer Angebote. 12x verlieh das Entscheidungsgremium den A-Status, 8x den B-Status sowie 3x den C-Status.
„Mit der REGIONALE 2022 nutzen wir die besondere Chance, in OstWestfalenLippe mit innovativen Strategien und beispielgebenden Projekten wirkungsvolle Zukunftsimpulse zu setzen. Dabei haben wir die rund zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in 70 Städten und Gemeinden, sechs Kreisen und der kreisfreien Stadt im Blick. Die zwölf neuen REGIONALE-Projekte tragen dazu bei und entwickeln attraktive Lebensumfelder, schaffen Orte der Gemeinschaft und stärken touristische Ziele“ hebt Landrat Jürgen Müller, Vorsitzender des UrbanLand-Board, des Entscheidungsgremium der REGIONALE, hervor.
„Wir haben bislang rund 135 Millionen Euro an Fördermitteln eingeworben, die ganz konkret bei Unternehmen, Kommunen, Hochschulen und Verbänden in der Region ankommen. Mit diesem hervorragenden Ergebnis haben die Beteiligten an der REGIONALE 2022 optimale Voraussetzungen für das Päsentationsjahr geschaffen. Das wird ein Jahr voller Austausch und toller Aktionen. Ein Jahr, das OWL weit über die Grenzen der Region hinaus sichtbar machen wird und auf das ich mich sehr freue“, so die Detmolder Regierungspräsidentin Judith Pirscher.
Die REGIONALE 2022 wurde 2017 durch das Landeskabinett der Region OstWestfalenLippe zugeschlagen. OstWestfalenLippe richtet die REGIONALE unter der Überschrift „Das UrbanLand“ aus. Ziel ist es, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu stärken. 2018 begann die strategische Arbeit. Insgesamt 145 Projektideen sind eingereicht. Stand Dezember 2021 gibt es 44 REGIONALE-Projekte (mit z.T. mehreren A-Beschlüssen). Im Präsentationsjahr 2022 soll das Urbanland OstWestfalenLippe im Rahmen eines Veranstaltungsprogramms sichtbar werden.
„Wir gehen jetzt ins Finale der REGIONALE 2022. Aber selbstverständlich kann das nur eine Momentaufnahme sein, denn das UrbanLand OstWestfalenLippe – die Vision von einer neuen Balance von Stadt und Land – ist ein Prozess. Im Jahr 2022 schaffen wir ein Schaufenster und blicken in die Region. Die Projektqualifizierung und die inhaltliche Arbeit gehen aber weiter - die Ärmel bleiben also hochgekrempelt. Wir gehen am Ende von etwa 60 REGIONALE-Projekten aus“, erklärt Herbert Weber, Geschäftsführer der OWL GmbH, bei der das NRW-Strukturentwicklungsprogramm REGIONALE 2022 gemanagt wird.
Neue REGIONALE 2022-Projekte
Neues Eingangs- und Ausstellungsgebäude für das LWL-Freilichtmuseum Detmold
Im deutschlandweit größten Freilichtmuseum in Detmold stehen auf 90 Hektar Fläche rund 120 vollständig eingerichtete Gebäude aus allen Landschaften Westfalens, die den geschichtlichen Hintergrund ländlichen sowie kleinstädtischen Bauens und Lebens zeigen. Das neue Eingangs- und Ausstellungsgebäude schafft den Brückenschlag von der Vergangenheit in die Zukunft. „Über die REGIONALE entsteht ein innovatives Gebäude, das konsequent ökologisch nachhaltig ausgerichtet ist, in dem traditionelle Materialien wie Holz und Lehm umfassend Verwendung finden. Die Qualitäten und das Wissen des ländlich geprägten Raums – beispielsweise zu Landschaftsökologie, Umwelt oder nachhaltigem Bauen – werden hier vermittelt und weiterentwickelt“, erläutert Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Mansergh Quartier, Gütersloh
Durch den Abzug der britischen Streitkräfte eröffnet sich nahe der Stadtmitte von Gütersloh mit dem REGIONALE-Projekt Mansergh Quartier ein 38 Hektar großes Kasernengebiet, das die Chance zur Bereitstellung von dringend benötigtem Wohnraum mit einer modernen Quartiersentwicklung bietet. „Mit dem REGIONALE-Projekt wird ein über 80 Jahre verschlossenes Areal zugänglich. Ziel dieses für die Stadt Gütersloh immensen Planungsvorhabens ist ein ökologisch nachhaltiges Wohn- und Bildungsviertel mit Grünflächen für die Bürgerinnen und Bürger, für Studierende und Freiberufler. Von den großzügigen Freiräumen innerhalb des Quartiers und im Dalke-Park profitiert die gesamte Stadt“, so Inga Linzel, Fachbereichsleiterin Stadtplanung Gütersloh.
Alanbrooke Quartier – Konversion in die Zukunft, Paderborn
Ein lebendiges Stadtquartier mit Wohnraumvielfalt und einem Zentrum der Kreativwirtschaft soll mit dem REGIONALE-Projekt Alanbrooke Quartier auf dem 18 Hektar großen ehemaligen Militärstandort im Herzen Paderborns entstehen. Denkmalgeschützte Kasernengebäude aus wilhelminischer Zeit machen den besonderen Reiz des Areals aus. Besonderen Wert legt die Stadt Paderborn auf qualitätssichernde Planungs- und Vermarktungsinstrumente.
„Mit dem Alanbrooke Quartier entsteht ein urbanes Stadtquartier mit rund 800 Wohneinheiten, gewerblichen Büro- und Dienstleistungsflächen, einer Kita und belebten Erdgeschosszonen. Einen wichtigen Beitrag zur Entstehung eines lebendigen Stadtquartiers soll neben dem öffentlichen Park ein offenes Zentrum für Kreativwirtschaft leisten. Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in die REGIONALE“, erläutert Lars-Christian Lange, Konversionsbeauftragter der Stadt Paderborn.
Neues Leben am Kohlenufer, Minden
Gegenüber der historischen Altstadt in Minden liegt auf der rechten Weserseite direkt am Bahnhof und alten Weserhafen ein Stadtraum mit herausragendem Potenzial. Das REGIONALE-Projekt „Neues Leben am Kohlenufer“ entwickelt modellhaft urbane Strukturen für Wohnen, Arbeiten und Kreativszene in Verbindung mit attraktiven Räumen am Wasser. Die ersten Schritte, wie zum Beispiel der Wettbewerb zur Weserpromenade oder die Machbarkeitsstudie für das Wohnen und Leben am Alten Weserhafen, stellen dafür eine sehr gute Grundlage dar. „Minden bekommt ein neues Quartier und betreibt hier ganzheitliche und zukunftsweisende Stadtteilentwicklung. Mehr noch: Das Wohnen am Wasser im alten Weserhafen wird spektakulär und ganz neue Lebensqualität in Minden anbieten. Die Sanierung und Neunutzung des historischen Bahnhofsgebäudes hat großes Potenzial für einen Zukunftsstandort zusammen mit dem REGIONALE-Projekt RailCampus OWL“, stellt Mindens Bürgermeister Michael Jäcke heraus.
Bahnhof Löhne als Dritter Ort
Das denkmalgeschützte Gebäude wird als Bürger- und Kulturbahnhof zum Begegnungsort mit Vorbildwirkung über Löhne hinaus entwickelt. Für das komplexe Vorhaben wurde in Zusammenarbeit von Verein „Löhne umsteigen“, Stadtverwaltung und engagierten Bürgerinnen und Bürgern ein Nutzungskonzept entwickelt, das durch das Programm „Dritte Orte NRW“ in einen Testbetrieb mit nachhaltiger Perspektive überführt wird. „Es entstehen Veranstaltungs- und Arbeitsräume, eine neue Stadtbibliothek sowie ein Kultur- und Lesecafé mit Bistro für nachhaltigen Handel. Wir entwickeln den Bahnhof zum neuen Entrée von Löhne. Ich freue mich über die Auszeichnung innerhalb der REGIONALE“, so Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller.
Digitaler Showroom Bad Oeynhausen
Das Teilprojekt „Digitaler Show-Room Bad Oeynhausen“ erhielt als neuer Baustein des REGIONALE-Projekts „Zukunftsfit Digitalisierung“ einen A-Beschluss. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Touristeninformation im Haus des Gastes im Herzen des Kurparks Bad Oeynhausen. „Wir freuen uns auf die Umsetzung und die Aufnahme in die REGIONALE 2022. Neben den digitalen Serviceangeboten sollen die Geschichte und Entwicklung des Kurbads hier Raum und Darstellung finden – die DNA Bad Oeynhausens sozusagen“, erläutert Bürgermeister Lars Bökenkröger.
Die Teilprojekte „Digitale Show Rooms“ setzten als Piloten die innovativen Möglichkeiten der Digitalisierung in Touristeninformationen um. Im Rahmen von "Zukunftsfit Digitalisierung" werden sechs Tourist-Informationen als sogenannte digitale Show-Rooms gestaltet.
Klimaquartier Sennestadt, Bielefeld
Mit dem REGIONALE-Projekt Klimaquartier Sennestadt wird auf dem ehemaligen Schillinggelände, einer Industriebrache, ein neues Kapitel der Sennestadt aufgeschlagen. Es entstehen eine Klimaschutzsiedlung und ein urbanes Gebiet – die größte Flächenentwicklung seit Jahrzehnten im Bielefelder Süden. Das Vorhaben besticht durch eine überzeugende Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie mit Siedlungspartnern, den Stadtwerken und der Sparkasse.
„Das Klimaquartier Sennestadt ist ein besonderer Laborraum, um für ein nachhaltiges Bielefeld modellhafte Verfahren, Technologien und Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Ich freue mich, dies auch in die REGIONALE einzubringen“, stellt Geschäftsführer Bernhard Neugebauer von der federführenden Sennestadt GmbH heraus.
Stadtgesellschaft im Denkmal – Kooperationsprojekt in OWL
Die fünf Städte Bad Driburg, Horn-Bad Meinberg, Höxter, Lemgo, Nieheim mit einer Einwohnerzahl zwischen 6.000 und 40.000 und ein Quartier der Großstadt Paderborn haben sich im Projektverbund „Stadtgesellschaft im Denkmal“ zusammengefunden. Ziel ist, durch die Aufwertung der Ortskerne einen umfassenden Impuls der Quartiersentwicklung zu setzen. Im Kooperationsprojekt werden fachlicher Austausch, Beratung und konkrete Zusammenarbeit organisiert. Dabei geht es sowohl um Fragen der Baukultur im Umgang mit den wertvollen historischen Gebäuden, als auch die Entwicklung neuer Nutzungsmodelle. Unter dem Dach der Kooperation setzen die Städte vor Ort jeweils ein Projekt um. Die Projektpartner haben für die beispielgebende Kooperation die Auszeichnung als REGIONALE-Projekt über den A-Beschluss erhalten.
Quartierszentrum Wippermann – Bürgerbildung im Baudenkmal
Das 1576 errichtete Haus Wippermann ist von der Stadt Lemgo mithilfe innovativer Techniken denkmalgerecht zu einem lebendigen Zentrum umgebaut. Als Teil des Kooperationsprojekts „Stadtgesellschaft im Denkmal“ steht es für integrierte Quartiersentwicklung. Die Volkshochschule Detmold-Lemgo ist Ankernutzerin. „Ein roter Faden des zukünftigen Angebots ist die Bildung. Das Quartierszentrum soll aber auch ein Ort für Begegnung und Integration sein. Wir wünschen uns, dass das Haus Wippermann ein neuer Anlaufpunkt wird und das neue innovativ gestaltete Nutzkonzept aufgeht“, so Karl Wessel, Geschäftsbereichsleiter Stadtplanung und Bauen Lemgo.
KulturScheune1a
Beispiel des großen ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der lokalen Bevölkerung der kleinen Kommune Fürstenberg/Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn ist das Konzept „KulturScheune1a“. Mit diesem REGIONALE-Projekt entsteht ein ehrenamtlich getragener Dritter Ort, der mit speziell für den ländlich geprägten Raum konzipierten kulturellen Angeboten wichtige Impulse für das UrbanLand setzt und zum attraktiven Dorfleben beiträgt.
„Die KulturScheune ist bereits jetzt ein Ort der Begegnung. Wir veranstalten Märkte, hier finden Workshops zu ganz verschiedenen Themen statt und es gibt ein Café-Angebot. Wir entwickeln das Konzept KulturScheune1a gemeinsam entlang der Interessen und Wünsche der Bevölkerung weiter. Jetzt freuen wir uns auf den Start der Sanierung, die die alte Zehntscheune ganzjährig nutzbar macht“, erklärt Peter Gödde von der KulturScheune1a UG.
DiD (Dorf im Dorf) - nachbarschaftliches & generationsübergreifendes Wohnen
„Um ein selbstbestimmtes Leben in einer aktiven Gemeinschaft zu fördern, entwickeln wir in Zusammenarbeit mit einer engagierten Gruppe von Bürgerinnen und Bürger im historischen Ortskern Nettelstedts im Kreis Minden-Lübbecke ein nachbarschaftliches und generationsübergreifendes Dorfquartier mit 45 Wohneinheiten“, erklärt Achim Grube, Vorstandssprecher GBSL Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lübbecke eG.
Vielfalt und Lebendigkeit entstehen durch die genossenschaftlichen Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Reihenhäuser, die sich um gemeinschaftlich genutzte Räume und Gärten im Hof gruppieren. Das Dorf-Café steht als Treffpunkt allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Menschen mit Unterstützungsbedarf werden in einer Pflegewohngruppe und durch eine kleine ambulante Pflegestation versorgt. Im Ergebnis entsteht ein Modell für modernes und vielfältiges Wohnen mit Versorgungssicherheit in einem kleinen Ort.
5G Lernorte für die Berufsbildung der Zukunft
Die OstWestfalenLippe GmbH trägt gemeinsam mit der Universität Paderborn, den Kreisen Gütersloh und Paderborn, dem Fraunhofer IOSB-INA und der Nachwuchsstiftung Maschinenbau das REGIONALE-Projekt „5G Lernorte OWL“. Ziel ist es, die Vorzüge und Grenzen der 5G-Technologie für die berufliche Bildung zu erforschen. Aus der Perspektive von 5G- und Bildungsforschung werden berufs-, orts- und organisationsübergreifende Lernszenarien für die Produktion der Zukunft entwickelt. Dabei liegt der Fokus auf vorausschauender Wartung sowie Qualitätskontrolle und Fernwartung. Die Szenarien werden in vier Berufskollegs in den Kreisen Gütersloh und Paderborn erprobt – sowohl mit gewerblich-technischen als auch kaufmännischen Auszubildenden.
„5G ist ein wichtiger Schlüssel, um Prozesse zu optimieren und neue Anwendungen zu realisieren – von der Industrie über die berufliche Bildung bis zu Mobilität und Gesundheit. Die Potenziale und Grenzen von 5G für diese Bereiche müssen Unternehmen, Forschungsinstitute und öffentliche Einrichtungen gemeinsam erschließen. Mit dem Projekt leisten wir Pionierarbeit für die berufliche Bildung und einen wichtigen Beitrag für die Fachkräftegewinnung. Die Aufnahme in die REGIONALE verleiht zusätzlich Strahlkraft“, so Wolfgang Marquardt, Prokurist und Leitung Regionalentwicklung in der OstWestfalenLippe. GmbH.
Weitere Projekte im Qualifizierungsprozess
An acht Projektkandidaten wurde durch das UrbanLand Board der B-Status verliehen.
Außerdem wurden drei Projektideen
über einen C-Beschluss das Potenzial zugesprochen, zur Umsetzung der UrbanLand-Gesamtstrategie beizutragen. Sie sollen weiter qualifiziert werden.
Presseinformation und Fotos zu den neuen Projekten finden sich hier zum Download: https://www.urbanland-owl.de/presse-und-medien/presseinformationen/